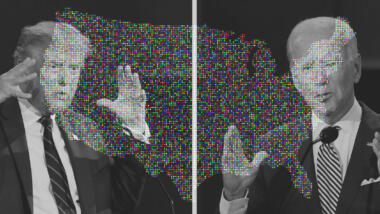Mehrere Lobbygruppen haben hunderte Anzeigen mit irreführenden Aussagen geschaltet, kritisiert die NGO Avaaz. Obwohl dies gegen Facebooks Regeln für Wahlwerbung verstößt, sei der Konzern nicht dagegen vorgegangen. Offenbar blieben selbst solche Anzeigen stehen, deren Inhalt von Facebooks Faktenchecks bereits als irreführend erkannt wurde.