Social-Media-Plattformen mit Sitz im EU-Ausland können vom deutschen Gesetzgeber nicht einfach verpflichtet werden, Nutzer:innen einen Widerspruchsmechanismus gegen die Löschung mutmaßlich rechtswidriger Inhalte bereitzustellen. Eine Vorgabe des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) für dieses sogenannte Gegenvorstellungsverfahren verstößt gegen Europarecht und ist ungültig. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen nach einer Klage des US-Konzerns Meta in letzter Instanz.
Facebook und Instagram müssen die vom NetzDG vorgesehenen Widerspruchs- und Wiederherstellungsmechanismen bei mutmaßlich strafrechtlich relevanten Inhalten nun nicht umsetzen (§ 3b Abs. 1 und 2 NetzDG). Gültig bleiben Gegenvorstellungsverfahren bei Inhalten, die aus sonstigen Gründen gelöscht wurden, etwa weil sie gegen die Community-Richtlinien oder Geschäftsbedingungen von Social-Media-Unternehmen verstoßen (§ 3b Abs. 3 NetzDG).
Diese neuen Regeln für Plattformanbieter hatte der Bundestag erst im Mai 2021 in einer Reform des NetzDG beschlossen. Sie sollten die Nutzer:innen vor Overblocking schützen und so die Meinungsfreiheit im Netz stärken. Auch diejenigen sollten ein Widerspruchsrecht bekommen, die einen Inhalt gemeldet haben, der nicht gelöscht wurde.
Gravierende Formfehler
Für die ehemalige Bundesregierung und vor allem die damalige Justizministerin Christine Lambrecht ist die Entscheidung eine herbe Schlappe. Über die grundsätzliche Zulässigkeit von Widerspruchs- und Wiederherstellungsmechanismen auf Social-Media-Plattformen sagt das Urteil nichts.
Das Oberverwaltungsgericht begründet den Schritt vielmehr mit formalen, europarechtlichen Verstößen der Bundesregierung. Konkret verstößt die Vorgabe gegen das Herkunftslandprinzip: Die e-Commerce-Richtlinie der EU sieht vor, dass Diensteanbieter grundsätzlich nur dem Recht des Mitgliedstaats unterliegen, in dem sie niedergelassen sind. Im Fall von Meta ist das Irland, weil dort der europäische Ableger des Konzerns seinen Sitz hat.
Abweichungen vom Herkunftslandprinzip sind zwar möglich, doch die Bundesregierung hat es laut Oberverwaltungsgericht verpasst, diese geltend zu machen. So habe Deutschland weder die EU-Kommission noch die betroffenen Mitgliedstaaten vor der Einführung der Regeln informiert und dazu aufgefordert, selbst entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Digital Services Act sieht Beschwerdeverfahren vor
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war eine Maßnahme der Bundesregierung im Kampf gegen Hassrede im Netz. Seit 2017 soll das NetzDG dafür sorgen, dass Social-Media-Anbieter mutmaßlich rechtswidrige Inhalte konsequenter löschen. Falls die Plattformen nicht schnell genug sind, drohen empfindliche Strafen. Zivilgesellschaft und Wissenschaft hatten Widerspruchsmechanismen lange Zeit zum Schutz der Meinungsfreiheit gefordert, damit Nutzer:innen sich wehren können, wenn Inhalte zu Unrecht gelöscht werden.
Auch wenn die späte Reform nun gekippt wurde: Die Idee des Gegenvorstellungsverfahrens lebt weiter und gilt ab 2024 sogar EU-weit. Dann entfaltet der Digital Services Act (DSA) seine Wirkung, mit dem die EU unter anderem einheitliche Regeln für die Inhalte-Moderation in Sozialen Medien geschaffen hat.
„In der Sache folgt aus der Entscheidung wenig“, kommentiert Benjamin Lück von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegenüber netzpolitik.org. Nach dem DSA müsste Meta bald sowieso ein internes Beschwerdemanagementsystem vorhalten, das dem Gegenvorstellungsverfahren des NetzDG weitgehend entspreche „Die Europäische Kommission dürfte diese Pflicht sogar wesentlich hartnäckiger und schneller durchsetzen als das bisher zuständige Bundesamt für Justiz.“
Wie viel Spielraum bleibt für nationale Plattformregulierung?
Allerdings könnten die Ausführungen des Gerichts zur Auslegung des Herkunftslandprinzips wichtig werden, so der Jurist weiter. Die Frage, welchen Spielraum einzelne EU-Staaten bei der Regulierung von Internetkonzernen mit Sitz im EU-Ausland haben, werde etwa beim Gesetz zum Schutz vor digitaler Gewalt relevant. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag verabredet, ein solches Gesetz einzuführen. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts könnte die Möglichkeiten hierfür deutlich einschränken.
Lück sieht im Digital Services Act jedoch gute Argumente „gegen ein so starr verstandenes Herkunftslandprinzip.“ Anders als die e-Commerce-Richtlinie stelle dieser „wesentlich stärker den Schutz der Nutzer:innen in den Mittelpunkt und nicht mehr vornehmlich die freien Diensterbringung durch Online-Anbieter.“ Zu diesem Schluss komme ein Gutachten, welches die Gesellschaft für Freiheitsrechte in den kommenden Wochen veröffentlichen werde.
Für die NetzDG-Reform der Großen Koalition war die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts unterdessen schon die zweite Schlappe. Eine andere Neuerung hatte das Verwaltungsgericht Köln zuvor bereits gekippt: Die Verpflichtung für Social-Media-Dienste, ihre Plattform nach potenziell strafbaren Inhalte zu durchsuchen und die Daten der Ersteller:innen an das BKA zu melden. Eine ähnliche Vorgabe findet sich allerdings ebenfalls im DSA.

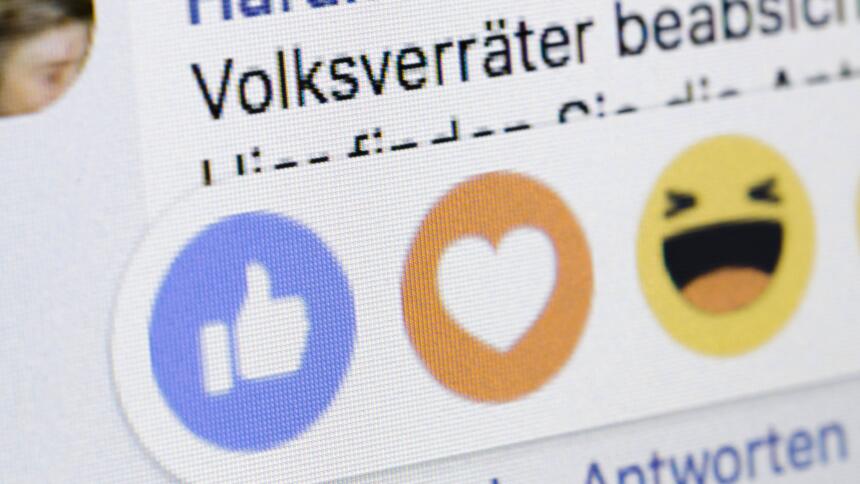



0 Ergänzungen
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr, daher sind die Ergänzungen geschlossen.