Das Internet trägt seit je her ein großes Versprechen in sich: Kreativschaffende sind nicht mehr auf traditionelle Vertriebswege angewiesen, um ihre Musik, Bücher oder sonstige Werke an die Öffentlichkeit zu bringen. Damit könnten Künstler:innen ihr Publikum direkt erreichen, ohne Rücksicht auf verkrustete Strukturen nehmen zu müssen – und vielleicht sogar völlig neue Kunst produzieren, die früher durch das Raster gefallen wäre.
Doch ganz ohne Mittler geht es weiterhin selten. Sogenannte Intermediäre wie Youtube, aber auch Online-Dienste wie Patreon, Kickstarter oder Onlyfans haben klassische Vergütungsmodelle und Vertriebswege teilweise ersetzt. Damit haben die neuen Dienste eine Machtposition erlangt, die mitunter problematisch sein kann. Statt Buchverlagen und Musiklabels entscheiden nun sie, welche Art von Werken sie auf ihrem Dienst erlauben und welche nicht. Wenn sie beispielsweise im Alleingang entscheiden, Nacktheit jeglicher Art auszuschließen, dann kann das potentiell weitreichende Folgen für die Kunstproduktion insgesamt sowie für die Kunst- und Berufsfreiheit der Nutzer:innen haben.
Insbesondere für die Schaffenden kann es gravierende Auswirkungen haben, wenn ein bislang genutzter Intermediär ihnen plötzlich den Dienst versagt. Schlagartig verlieren sie den Zugang zu einem mühsam aufgebauten Publikum – und womöglich zu ihrer Haupteinnahmequelle.
Wie privat sind die Privaten?
Diesem Spannungsfeld widmet die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) die jüngst erschienene Studie „Monetarisierungsplattformen und Grundrechte“. Sie ist die dritte Ausgabe der Studienreihe „Grundrechte im Digitalen“, zuvor nahm die Nichtregierungsorganisation die Grundrechtsbindung sozialer Medien und die von App Stores unter die Lupe.
Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, inwieweit private Unternehmen überhaupt Grundrechten verpflichtet sind. Die GFF-Studie stützt sich hierbei auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesgerichtshofs. Demnach besteht zwar keine unmittelbare Bindung der Privaten an das Grundgesetz. Dennoch müssen unter bestimmten Umständen etwaige Einschränkungen dem Gleichbehandlungsgebot entsprechen. Außerdem dürfen Verfahrensrechte nicht willkürlich eingeschränkt werden.
Das heißt zum Beispiel, dass ein marktbeherrschendes soziales Netzwerk wie Facebook Regeln aufstellen darf, die schärfer sind als die strafrechtlichen Vorgaben des Staates. Aber wenn der Anbieter Inhalte löscht, Hassrede etwa, müssen die Betroffenen zumindest Gelegenheit haben, ihre Sicht der Dinge darzulegen.
Noch keine Marktkonzentration feststellbar
Auch wenn sich viele der Problemstellungen ähneln, lassen sie sich nicht über einen Kamm scheren – selbst wenn man sich nur jenen Online-Diensten widmet, die sich als Monetarisierungsplattformen einordnen lassen, so Studienautor Jürgen Bering.
Derzeit gebe es eine große Anzahl solcher Dienste, die sich in ihrer konkreten Ausgestaltung teilweise stark voneinander unterscheiden würden. Bis zu einem gewissen Grad seien sie aus Sicht der Kreativschaffenden dennoch untereinander austauschbar. Sollte sich ihnen ein Dienst verweigern, dann könnten sie einfach woanders unterkommen. Die Situation ist somit eine andere als bei Sozialen Medien. Deshalb sei „nicht davon auszugehen, dass die Plattformen die Voraussetzungen für eine Grundrechtsbindung erfüllen“, konstatiert Bering.
Zugleich werden viele der grundrechtlichen Problemkonstellationen vom Digital Services Act (DSA, auf Deutsch „Digitale-Dienste-Gesetz“) erfasst. Das im Vorjahr verabschiedete und schrittweise in Kraft tretende EU-Regelwerk stelle Regelungen für die Plattformen auf, die mit den aus der Grundrechtsbindung resultierenden Verpflichtungen vergleichbar sind, schreibt Bering.
Auch die Anbieter von Monetarisierungsdiensten sind dann verpflichtet, transparente Nutzungsbedingungen zu schaffen, die auch die Grundrechte der Nutzer:innen berücksichtigen. Zudem müssen sie Verfahrensregelungen beachten, wenn sie Inhalte löschen. So haben sie ihre Löschentscheidung zu begründen sowie ein Gegenvorstellungsverfahren anzubieten, mit dem sich Nutzer:innen dagegen wehren können.
Digital Services Act macht keine inhaltlichen Vorgaben
Allerdings enthalte der DSA keine Regelungen, welche inhaltlichen Anforderungen an Einschränkungen gestellt werden, heißt es in der Studie. Soll heißen: Die Online-Dienste können weiterhin einigermaßen willkürliche Nutzungsbedingungen aufstellen, solange sie sie nur auf alle Nutzer:innen gleich anwenden. Ob dann letztlich die Verpflichtung zur Berücksichtigung der Grundrechte von Nutzer:innen über die inhaltlichen Anforderungen gestellt werden kann, werde sich erst in der Anwendungspraxis ergeben.
Und die Studie deckt eine mögliche weitere Schutzlücke im DSA auf. Zwar nehmen die kommenden Regeln die Grundrechte einzelner Nutzer:innen in den Fokus, „ohne jedoch sicherzustellen, dass Plattformen auch die Auswirkungen auf größere Nutzer:innengruppen im Auge haben“. So könne es sein, dass die Gesamtwirkung von Maßnahmen auf marginalisierte Gruppen nicht hinreichend betrachtet werde.



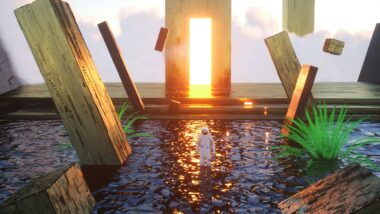

Direkt: »jmdn. unmittelbar, persönlich betreffend, an jmdn. persönlich gerichtet« auch »in gerader Richtung, ohne Umweg verlaufend, auf ein Ziel gerichtet« deshalb indirekt wenn ein Dritter, eine Platform beteiligt ist. Bezahlende auf OnlyFans, Unterstützende auf Patreon, Finanzierende auf Kickstarter könnten sich die Gebühren an die Platformen sparen und sich direkt (…) sie tun es allerdings indirekt, über eine Plattform.