Unsere Daten müssen endlich wieder uns gehören. Mit diesem Appell lässt Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner im Januar aufhorchen. In einem offenen Brief an Ursula von der Leyen wettert er gegen den „Überwachungskapitalismus“ von Firmen, die ihre Kund:innen ausspähen und fordert die Kommissionschefin auf, endlich etwas gegen die digitalen Giganten Google und Facebook zu machen.
13 Tage später trifft ein Springer-Lobbyist virtuell den obersten Digitalberater Von der Leyens. Thema des Treffens: Europas digitale Zukunft. Dort klingt der Tonfall anders als in Döpfners Brief.
Abseits der Öffentlichkeit jammert der Springer-Konzern, dass er die Einwilligung von Menschen einholen muss, die er im Netz tracken möchte. Diese lästige Pflicht hätten die Digitalriesen nur einmal, da Nutzende sich bei ihnen einloggen. Andere Anbieter müssten Einwilligungen „hundert Mal“ einholen. Die ePrivacy-Verordnung der EU könne Springer außerdem verbieten, den Besuch seiner Webseiten an die Datenschutz-Einwilligung zu koppeln, klagt der Konzern – eine Praxis, die Datenschutzbehörden seit Jahren skeptisch beäugen. Den Inhalt des Treffens hält die Kommission in einer Gesprächsnotiz fest, die auf Anfrage von netzpolitik.org öffentlich wird.
Wer für Springer an dem Treffen teilnahm, geht aus der Akte nicht hervor. Doch der Lobby-Besuch verdeutlicht: Springer ist – allen Appellen Döpfners zum Trotz – ein Konzern, der es auf persönliche Daten abgesehen hat. Sein Geschäft mit datengefütterter Online-Werbung baut der Konzern stetig aus. Das ist der „Überwachungskapitalismus“, den der Springer-Chef gern kritisiert.
Mehr noch, als Apple iPhone-Apps das Tracking ihrer Nutzer:innen verbietet, schalten deutsche Branchenverbände das Bundeskartellamt ein. Apple schließe „faktisch alle Wettbewerber von der Verarbeitung kommerziell relevanter Daten“, erklärt der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der Springer nahesteht. Datensammeln und Leute ausforschen dürfen nur wir, scheint die Botschaft.
Widersprüche wie dieser hindern den Axel-Springer-Konzern nicht daran, eifrig auf neue Gesetze gegen Big Tech zu drängen. Nach dem Vorbild Springers schielt die Verlagslobby sogar auf Von der Leyens digitales Schlüsselprojekt, den Digital Services Act.
Verlage hoffen auf Kohle von Google
Das neue EU-Gesetz soll die Spielregeln für viele Dienste im Netz ändern. Extra-Auflagen schafft es für Anbieter wie Google, deren Dienste dutzende Millionen Menschen in der EU nutzen. Die Verlagsbranche will das Gesetz verwenden, um ihr Lieblingsprojekt voranzutreiben: das Leistungsschutzrecht. Google und und andere Suchmaschinen sollen den Verlagen ein Entgelt dafür zahlen, auf ihre Nachrichten verlinken zu dürfen.
Das Leistungsschutzrecht ist bereits EU-Recht, geschafft haben das die Verlage schon 2019 in der Urheberrechtsreform. Deren Beschluss erfolgte gegen massive Proteste der Internetkonzerne, aber auch der Zivilgesellschaft. Das Leistungsschutzrecht beschränkt nach Meinung seiner Gegner:innen die Freiheit im Netz, Inhalte zu verlinken. Selbst kürzeste Teasertexte sind damit vergütungspflichtig, davon profitieren wohl vor allem Verlage wie Axel Springer. Sogar wenn das nur für Suchmaschinen gilt, werde ein gefährliches Vorbild etabliert, sagen Kritiker:innen.
Die EU-Richtlinie für das neue Urheberrecht ist seit zwei Jahren Gesetz, doch haben sie die meisten Staaten noch nicht umgesetzt. Auch Deutschland trödelt, schon weil der Widerstand groß ist. Nur ein Staat hat die Richtlinie bislang im nationalen Recht verankert: Frankreich. Dort einigte sich Google und verteilt nun Millionen Euro an die Verlage. So soll es in Deutschland auch sein, hofft die Branche hierzulande.
Hell strahlt das Vorbild Australien
Ihr Lobbyerfolg vor einigen Jahren reicht der Verlagsbranche freilich nicht mehr. Zu hell strahlt das Vorbild Australiens, wo ein neues Mediengesetz eine Vergütungswelle von Google und Facebook an die Verlage rollen ließ. Geheime Zutat des australischen Gesetzes ist aus Sicht der Medienbranche eine Klausel des geplanten Entwurfs, der die Internetkonzerne in Verhandlungen mit den Verlagen zwingt.
Das wünschen sich die Presseverlage lautstark auch in Europa. Ohne den „australischen Ansatz drohen die dominanten Tech-Firmen, aus den Verhandlungen auszusteigen oder die [EU-]Märkte ganz zu verlassen“, warnt Angela Mills Wade vom European Publishers Council, dem der Axel-Springer-Verlag und andere Branchengrößen angehören.
Ähnlich tönt Springer gegenüber dem Kabinett Von der Leyens. Der Entwurf der Kommission für das Digitale-Märkte-Gesetz, das Teil des Pakets um den Digital Services Act ist, sei ein guter Start. „Aber es muss auch ein Verhandlungsrecht für das Leistungsschutzrecht erwogen werden“, sagt der Springer-Lobbyist.
Vorstellig wurde ein Lobbyist Springers wenige Tage vor dem offenen Brief Döpfners auch beim Kabinett von Digitalkommissar Thierry Breton. Auch dort ging es um Urheberrecht und das Digitale-Märkte-Gesetz. Genaueres will die Kommission in diesem Fall nicht verraten – eine weitere Gesprächsnotiz, die netzpolitik.org angefragt hat, bleibt geheim.
Auf eine Frage nach den Treffen betont ein Kommissionssprecher, die Urheberrechtsreform bringe bereits konkrete Ergebnisse für den europäischen Mediensektor, das zeige das französische Beispiel. Die Kommission erwarte „positive Resultate auch in anderen Staaten“, die die Richtlinie umsetzen, heißt es auch in einer Antwort an das EU-Parlament.
Wie eng die politische Bande zwischen Springer und Von der Leyen ist, macht ein Blick kaum zwei Jahre zurück deutlich. Im November 2019 ging der Axel Springer Award an die US-Professorin Shoshana Zuboff, Autorin von „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“. Die Laudatio hielt Von der Leyen, die Wochen später ihr Amt als Kommissionspräsidentin antrat.
In Vorbereitung darauf engagierte sie die PR-Firma von Kai Diekmann, der als Ex-Chefredakteur der „Bild“ im Hause Springer bestens vernetzt ist. Von der Leyen beendete den privaten Beratervertrag erst nach monatelanger Kritik, dass es sich um ein intransparentes Arrangement handle. Axel Springer ist außerdem Ko-Eigentümerin der Nachrichtenseite Politico.eu, die in der Brüsseler Politikblase als einflussreich gilt.
Freilich, als der Springer-Lobbyist in Brüssel vorspricht, ist es zu spät. Die Kommission machte ihre Vorschläge für das große Plattformgesetz bereits im Dezember. Der Ball liegt nun beim Rat der Mitgliedsstaaten und beim EU-Parlament. Dort werden die Vorschläge aus dem Hause Springer mit merklich wenig Enthusiasmus aufgenommen.
Ex-Kommissar Ansip: „Keine gute Idee“
In Europas Abgeordnetenkammer kommt die Reform bislang schleppend voran. Mehrere Ausschüsse rangelten Monaten darum, welcher am meisten Mitsprache für den Digital Services Act erhält. Indes melden sich Interessenvertreter lautstark zu Wort. In Brüssel unken einige bereits, das Plattformgesetz werde die Lobbyschlacht um die EU-Urheberrechtsreform in den Schatten stellen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass Abgeordnete, die netzpolitik.org auf den Vorschlag der Verlagslobby anspricht, wenig darauf erpicht sind. „Ich denke, das ist keine gute Idee“, sagt Andrus Ansip. Der Abgeordnete aus Estland muss es wissen, immerhin steuerte er vor zwei Jahren die Copyright-Reform als Digitalkommissar durch den Gesetzgebungsprozess. Heute verhandelt Ansip im Parlament als Berichterstatter der liberalen Fraktion Renew über das Digitale-Märkte-Gesetz.
Er sei nicht grundsätzlich gegen den Wunsch der Verlage, sagt Ansip, aber er scheue davor zurück, die kontroverse Urheberrechtsdebatte erneut zu öffnen. Das Digitale-Märkte-Gesetz drohe zur „never-ending story“ zu werden, zu unendlichen Geschichte.
Streitbeilegungsmechanismen wie jenen, den die Verlage nun forderten, gebe es bereits in der Urheberrechtsrichtlinie, sagt die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt. Die Mitgliedsstaaten müssten die Richtlinie nun erstmal umsetzen. Um die Situation der Verlage zu verbessern, sollten eher die allgemeinen Fairnessklauseln für Plattformen im Digitale-Märkte-Gesetzes gestärkt werden, sagt Gebhardt. „Damit könnten viele der Probleme der Verlagsbranche angegangen werden, zum Beispiel, unilateral verhandelte Verträge, niedrige Vergütungen, die Auferlegung von unfairen Vertragsbedingungen oder aber die Drohung eines willkürlichen einseitigen Aufkündigens.“
Es sei eine „reine Illusion“, dass das Leistungsschutzrecht gleiche Spielregeln für alle journalistischen Angebote schaffe, sagt Martin Schirdewan, Ko-Fraktionschef der Linken im EU-Parlament. „Die Plattformen zwingen die Verlage in individuelle, intransparente Verträge, die nur dazu führen, dass die Verlage durch die Plattformen gegeneinander ausgespielt werden.“ Das stärke große Verlagshäuser wie Springer, kleinere Verlage säßen bei den Verhandlungen am Katzentisch. Die EU-Kommission solle lieber den Weg zu einer starken Digitalsteuer freigeben, um mit dem Geld Journalismus zu fördern.
Das australische System zu übernehmen, sei ineffizient und verschlimmere die Abhängigkeit von den großen Tech-Plattformen, betont auch Marcel Kolaja von den tschechischen Piraten, der die Grünen-Fraktion in den Verhandlungen vertritt. Seine Partei bekämpfe das Leistungsschutzrecht seit Jahren, da es die Netzfreiheit und den Medienpluralismus schwäche.
CDU-Berichterstatter nennt Verlagswünsche „zu vage“
Eine Schlüsselfigur im Parlament ist Andreas Schwab, ein CDU-Abgeordneter aus Baden-Württemberg. Schwab ist Berichterstatter des mächtigen Binnenmarktausschusses für das Digitale-Märkte-Gesetz und damit so etwas wie der Chefverhandler des Parlaments. Gegenüber netzpolitik.org sagt er, die bisher bekannten Überlegungen der Verlage seien „zu vage“, um sie beurteilen können. Das Parlament müsse sich erst in Anhörungen einen Überblick über die Positionen von Interessenvertretern verschaffen, bevor solche Vorschläge beurteilt werden könnten.
Seine persönliche Präferenz sei, das Digitale-Märkte-Gesetz zügig zu verabschieden, betont Schwab. Ob sich das erreichen lässt, wenn der Streit übers Urheberrecht aufs Neue aufflammt, lässt der CDU-Abgeordnete offen.
Sind damit die Hoffnungen Springers und der Verlage, den australischen Turbo für das Leistungsschutzrecht zu schaffen, schon wieder am Ende? Noch steht der Diskussionsprozess um das Digitale-Märkte-Gesetz an seinem Anfang, viel kann noch passieren. Dass die Presseverlage ihr Lobbying einstellen, erscheint unwahrscheinlich. Doch bei dem gewaltigen Plattformgesetz, dessen Bestimmungen sich auf hunderttausende Firmen in Europa auswirken könnten, ist ihre Stimme nicht unbedingt die lauteste.
Von der Leyen antwortet Döpfner noch im Januar mit einem eigenen offenen Brief. Zu Recht weise Döpfner auf die Macht der Tech-Konzerne hin, schreibt die Kommissionschefin. Es stimme, was der Springer-Chef über die Ausbeutung persönlicher Daten für kommerzielle Zwecke sage. Und ja, die Menschen müssten vor dem „Überwachungskapitalismus“ geschützt werden.
Versprechungen macht Von der Leyen Döpfner allerdings nicht. Die Maßnahmen, die sie in ihrem Brief schildert, sind alle längst angekündigt und haben nichts mit den Sonderwünschen der Verlage zu tun, eigene Regeln für Datenschutz und Urheberrecht zu bekommen. Auf die Kritik Döpfners, Europa unternehme zu wenig gegen die Digitalkonzerne, leistet sich Von der Leyen als Replik sogar eine kleine Spitze.
„Lieber Herr Döpfner, Sie sehen: wir sind längst dabei, die Chance Europas zu nutzen.“ Das klingt, als möchte die Kommissionspräsidentin dem Axel-Springer-Verlag und seinem geschäftigen Chef wissen lassen: Es geht auch ohne Zurufe von der Seitenlinie.


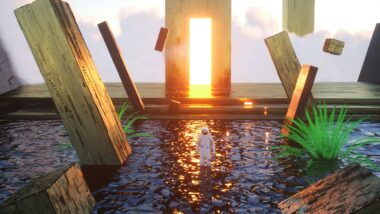


Nie vergessen: Döpfner ist selber Springer Großaktionär (durch Schenkung und Steuersparmodell).
Und der Axel-Springer Verlag hat bis auf seinem Kampagnen-Vehikel „Bild“ und schon immer defizitaere „Welt“ laengst alle Zeitungen verkauft und macht sein Geld mit digitalen Dienstleistungen.
Doepfner kann also nur gewinnen, denn auch ein Gesetz zum Schaden der Verlage staerkt seine Firma.