Das Verschwimmen der Rollen von Produzent und Konsument im Netz – von Netzpolitik über bürgerliche Freiheiten, Institutionen und Regulierung zum Digitalen Gesellschaftsvertrag
Von Netzpolitikaktivisten wird regelmäßig angenommen, sie wären strikt gegen Regulierung im Internet, denn es gilt die anarchistische Hackerkultur hochzuhalten. Als die grüne Bundestagsfraktion einlud, beim 12. Netzpolitischen Kongress der Grünen Beiträge zum angestrebten Digitalen Gesellschaftsvertrag einzubringen, habe ich daher die Gelegenheit ergriffen zu präsentieren, warum Netzpolitik notwendig Regulierung bedeutet, und weshalb es das gegenwärtige Rumgedoktore an Symptomen zu überwinden gilt. Naturgemäß ging es vorrangig um Freie Software, die Ökonomie des Internets, kreative Zerstörung und die digitale Gesellschaft. So ist hoffentlich für jeden was dabei. Der Beitrag ist zugegebenermassen etwas länglich, weil er sich am Inhalt des Workshops orientiert.
Das Internet bewirkt vor allem eine Veränderung im Umgang mit Informationen – sie sind jederzeit verfügbar, von zunehmend hoher Qualität, und es können wesentlich mehr Informationen in der gleicher Zeit verarbeitet werden. Was bedeuten diese technischen Offensichtlichkeiten für das Wirtschaften? Dazu ist es notwendig, sich Voraussetzungen für das Funktionieren des neoklassischen Marktmodells zu vergegenwärtigen – vollkommene Information, viele uniforme Marktteilnehmer und eine hohe Anzahl von Transaktionen. Diejenigen Märkte, für welche die im Internet verfügbaren Informationen relevant sind, werden also effizienter – Transaktionen können schneller und zu geringeren Kosten abgewickelt werden und es ist leichter, sich umfassend zu informieren und dadurch bessere Entscheidungen zu treffen. Diese durch das Internet induzierte verbesserte Effizienz der Märkte ist eine der Ursachen sowohl für das Gefühl des Agierens auf Augenhöhe des Netzbürgers untereinander als auch für das Wegbrechen von warmen Nischen, in denen sich Anbieter komfortabel breitgemacht hatten.
Das Internet ist das Medium, in dem sich Akteure und Informationen tummeln. Freie Software ist das Werkzeug, dass sie zusammenbringt. Ohne sowohl freie als auch kostenlos verfügbare Produktionsmittel würde das Internet nicht annähernd die Akzeptanz und insbesondere die wehrhafte Unterstützung erfahren, die gerade sichtbar wird (siehe ACTA). Durch diese einladende Ausgangssituation werden Internetnutzer gleichzeitig zu Produzenten und Konsumenten. Dieses Prinzip war zu Pionierzeiten noch deutlicher – einer der frühen Kritikpunkte an den heute üblichen asymmetrisch schnellen Internetzugängen war, dass dadurch die dezentrale Peer-to-Peer-Struktur des Internet untergraben wird. Obwohl weniger prominent, wirkt dieses Prinzip aber noch heute, und nicht nur bei Journalismus, Musik und Photographie, wo Nutzer originär an der Erstellung der Produkte beteiligt sind. Auch unterschwelliger sind wir alle Produzenten: in soziale Netzwerken dokumentieren wir die Beziehungen zwischen allen möglichen Aspekten des Lebens (und machen sie dadurch ökonomisch verwertbar, durch wen auch immer), und durch Bewertungen übernehmen wir die Filterung der verfügbaren Daten nach Relevanz und Qualität. Diese Metainformationen sind nicht weniger wichtig wie die ursprünglichen, auf die sie verweisen, was daran deutlich wird, dass die Geschäftsmodelle grosser Unternehmen wie Twitter darauf aufbauen diese zu sammeln. Insgesamt sind nicht nur ausgesprochen niedrige Barrieren zu überwinden, um selbst mit zu produzieren, es wird darüber hinaus aktiv darum geworben – nicht zuletzt, weil der Wert dieser riesigen Datenmengen nicht vorrangig dem Nutzer, sondern den dominanten Datensammlern im Netz zu Gute kommt. Jedenfalls ist das Read/Write Internet das Ergebnis, eine Gemeinschaft, in der die Unterscheidung von Produzent und Konsument schwerer wird und sich deshalb Regulierung nicht mehr so schön mit den jeweils Betroffenen einzeln verkungeln lässt.
Wat dem eenen sin Uhl, is dem anneren sin Nachtigal. Effizientere Märkte bedeuten vor allem mehr Wettbewerb und damit mehr Anpassungsdruck, mehr kreative Zerstörung. Jedes neue Produkt ersetzt ein vorheriges, so das es nicht verwunderlich ist, dass sich all diesen neuen Entwicklungen massiver Widerstand entgegenstellt mit dem Ziel, diese wenn nicht ganz zu verhindern, dann doch anständig zu verlangsamen. Wenn wir heute Filmkritiken aus dem Kinosaal verschicken, schadet das nicht nur dem Umsatz von schlechten Schinken, es bleiben auch Berufskinokritiker auf der Strecke, deren Meinung auf einmal kaum noch einen Kinogänger interessiert. Es geht aber auch ernsthafter – (Mikro-) Blogging aus politischen Krisengebieten ersetzt Vor-Ort-Journalismus und ist gleichzeitig schneller und authentischer. Produktbewertungen durch Kunden konkurrieren um die Deutungshoheit etablierter Produkttester, weshalb sie auch gern manipuliert werden – die Stiftung Warentest fährt dieses Jahr zum ersten Mal einen Verlust ein. Auch das ist Teil der digitalen Gesellschaft.
Eine Institution ist ein Regelsystem, welches eine bestimmte soziale Ordnung hervorruft, sagt Wikipedia. Dieser recht weit gefasste Begriff umfasst nahezu alles, woran wir uns gewöhnt haben, insbesondere formelle und informelle Institutionen – Ämter, Vereine, Unternehmen, aber auch das System der Berufsausbildung und die Repräsentanten der Zivilgesellschaft. Woher aber kommen die Regeln für das Regelsystem? Sie entstehen organisch aus dem Umfeld, den Interessen und Aktivitäten der Beteiligten, und erwachsen zur Norm. Oft bewirken sie den Ausgleich von sozialen Interessenkonflikten, oder dienen als Fokalpunkt der Willensbildung. Die Kombination von Internet und Freier Software verändert dieses Umfeld schlagartig (zumindest aus historischer Perspektive), und zwingt dadurch alle betroffenen Institutionen (also praktisch alle) zur Adaption. Obwohl Institutionen aber entstehen, wenn Menschen zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel, entwickeln sie ein Eigenleben. Sie überdauern nicht nur oft ihre Nützlichkeit, sie verwechseln auch oft ihre konkrete Aufgabe mit der Zeit mit ihrem Daseinsgrund. Passen sie sich nicht effizient genug an, werden sie vom formenden Korsett zur Zwangsjacke. Es ist nicht so, dass sich Institutionen nicht auch weiterentwickeln. Die Anpassung ist aber ein langsamer, vom Leidensdruck getriebener Prozess, der oft genug vom Widerstand gegen notwendige Veränderungen geprägt ist.
Ein paar Beispiele mögen das verdeutlichen. Verfassungsorgane sind natürlich prominente Institutionen, bei denen wir uns deutlich bewusst sind, wie sie durch ihr Umfeld geprägt wurden und sich entwickelten. Unser System der repräsentativen Demokratie ist wesentlich von der Annahme beeinflusst, dass es notwendig ist, wenige Repräsentanten auszuwählen, die dann im Namen aller temporär regieren. Dies ist deswegen notwendig, weil es nicht möglich ist, den Bürger vor jeder einzelnen Entscheidung zu seine Meinung zu befragen. Ist das wirklich noch so? Die Piratenbewegung ist entstanden, weil mit dem Internet die Möglichkeiten der politischen Beteiligung umfassender geworden sind – die einzelne Befragung ist nur einen Klick entfernt, die Kosten sind zu vernachlässigen. Der bestehende Prozess der politischen Willensbildung wirkt veraltet, es entsteht Anpassungsdruck. Trotzdem ist aber zu erwarten, dass (Berufs-)Politiker und Verwaltung weiterhin vor der drohenden Unbill von direkter Demokratie und Volksentscheiden warnen. Völlig uneigennützig, oder als Teil der von Veränderung bedrohten Institutionen?
Freie Software und Peer Production, das Modell, in dem Menschen gemeinsam, kollaborativ an der Erstellung von Gemeingütern arbeiten, bieten eine Alternative zur sonst üblichen Produktion durch Unternehmen oder den Staat. Das Internet ermöglicht eine weitreichende Arbeitsteilung und erleichtert die Koordination, das Zusammensetzen der vielen kleinen Contributions zu einem Ganzen. Dabei setzt der Austausch von Leistungen nicht auf Geld auf, so dass Preisfindung zumindest keine zentrale Rolle spielt. Das Mitwirken wird oft vorrangig als sinnstiftend betrachtet und ist intrinsisch motiviert. Behörden und Unternehmen sind die klassische Alternative zur Community, aber nur, weil es selbst bei Gemeingütern keine Alternativen gab. Und so bemühen sie sich zu begründen, warum trotzdem Schulbücher kein Gemeingut sein sollen, warum ein Leistungsschutzrecht die Verbreitung von Informationen mehr fördert als offenes Berichten im Netz, warum offener Zugang zu Nahverkehrsdaten doch keinen Nutzen stiftet, und so weiter.
Sehr spannend steht es um die Institution der professionellen Ausbildung, vom Beruf bis zum Studium. Schon länger steht sie in Konkurrenz mit dem fortlaufenden lebenslangen Lernen. Mit der wachsenden Bedeutung der professionellen Reputation im Internet sieht sie sich einer entscheidenden Herausforderung gegenüber. Ein Facharbeiterbrief oder ein Diplom sind nichts weiter als verbriefte Reputation, noch dazu statisch. Sie repräsentieren nur unzureichend den tatsächlichen Erfahrungsschatz einer Person. Dieser aber wird zunehmend genauer durch deren digitales Bild im Internet bestimmt, bei Köchen durch Restaurantbewertungen, bei Handwerkern und Versandhändlern durch Käuferfeedback, bei Bloggern durch die Anzahl Followers, bei Experten durch deren LinkedIn-Endorsements und -Empfehlungen. Ist ein Blogger mit grosser Gefolgschaft ein besserer oder schlechterer Berichterstatter als ein Absolvent der Journalistenschule ohne solche? „Show me the code“ lautet ein Motto der modernen Arbeitswelt, und verdeutlicht eine neue Kultur der Schaffenden: Reputation statt Jobtitel, Ergebnisse statt Anzug. Nicht umsonst findet sich Widerstand dagegen insbesondere von denen, deren verbriefte Reputation besonders wertvoll erscheint – Ärzte und Lehrer protestieren gegen Bewertungsportale und Professoren wehren sich überraschend gegen Forderungen nach Open Access.
Die Politik findet sich in der Rolle wieder, den aufgezeigten Konflikt zwischen der Freiheit des einzelnen Produ-Konsumenten und dem (positiv ausgedrückt) den Wandel gestaltenden Lobbyismus der etablierten Institutionen durch Regulierung aufzulösen. Während der BDI noch erklärt, das Internet wäre Marktplatz und nicht öffentlicher Raum, um damit Sperrforderungen bei Urheberrechtsverletzungen durchzusetzen, sind sich Politiker zunehmend bewusst, im Netz den (virtuellen) öffentlichen Raum der Zukunft zu sehen, den Raum, im dem sich der politische Willensbildungsprozess abspielt. Gestalten oder Erhalten wird damit zur zentralen Frage der Netzpolitik. Gestalten der errungenen Freiheiten des Netzbürgers, insbesondere von Freiheiten definiert als Abwesenheit von Zwang oder Missbrauch, oder Erhalten von bestehenden Institutionen, auch wenn dies bedeutet, dem Bürger zur Teilnahme zu zwingen.
Sicherlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen Erhalten und Gestalten, im Ausgleich von Interessen. Will man einen länger als eine Wahlperiode gültigen Gesellschaftsvertrag für das Digitale Zeitalter erarbeiten, dann kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, in dem Symptome kuriert (das Kopieren verhindert, der Provider haftbar gemacht, das Umgehen von DRM-Massnahmen verboten) werden. Statt dessen sollten dauerhaftere Prinzipien zum Kern eines solchen Vertrags werden. Die Minimierung und transparente Legitimation von Zwang als Trade-Off zwischen dem öffentlichen und dem Interesse des Einzelnen sind dabei von zentraler Bedeutung. Drei dieser Prinzipien sollten sein:
- Recht auf Zugang zum Internet: Wenn das Internet ein öffentlicher Raum ist, kann dem Bürger der Zugang nicht auf Grund von Grundrechten nachgeordneten Gesetzen entzogen werden, der Massnahme fehlte die Verhältnismässigkeit. Umgekehrt bedeutet das Recht auf Zugang auch, dass es hoheitliche Aufgabe ist, jedem Bürger Zugang zu ermöglichen.
- Netzneutralität: Mit Zensur kann kein Prozess der politischen Willensbildung funktionieren. Bürger brauchen die Sicht auf das echte Netz. Neutralität, der ungefilterte, nicht diskriminierende Zugang zum Internet, muss die Norm sein.
- Recht auf informationelle Selbstbestimmung: Das virtuelle Bild des Ichs bestimmt dauerhaft die persönliche Reputation, das eigene Erscheinungsbild. Die Kontrolle des Bürgers über seine öffentlich bereitgestellten Daten ist wesentliche Voraussetzung für einen zivilen Umgang miteinander. Davon leiten sich Forderungen nach (durchsetzbaren) Löschoptionen, nach interoperablem Export und Import zwischen Diensten und nach Gerätehoheit, also nach selbstbestimmter Verwendung der Geräte ab.
Letztlich bedeuten alle diese Entwicklungen einen Übergang von der technischen Umwälzung Internet zum Internet im Alltag, bei dem Vernetzung Normalität ist, und die Anwendungen des Vernetztseins im Vordergrund steht. Die digitale Bürgerbewegung setzt sich also deutlich nicht gegen Regulierung ein, sondern für einen Gesellschaftsvertrag im Digitalen Zeitalter, der auf Prinzipien basierende Rahmenbedingungen für das Leben im Netz für Netzbürger und Institutionen schafft.

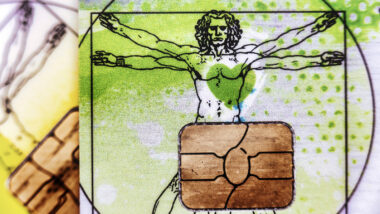


„Woher aber kommen die Regeln für das Regelsystem? Sie entstehen organisch aus dem Umfeld, den Interessen und Aktivitäten der Beteiligten, und erwachsen zur Norm.“
Das ist eine sehr romantische Vorstellung (der immerhin Friedrich Carl von Savigny anhing).
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Kodifikationsstreit
http://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Beruf_unserer_Zeit
ich will nicht sagen, dass die Auffassung unrichtig ist, aber man kann sie wohl geistesgeschichtlich verorten und sodann „auf den Schultern von Riesen“ zu einem weiteren Ausblich gelangen.
Einverstanden. Ich denke aber, dass die Schlussfolgerungen aus der Argumentation (Recht auf Zugang, Netzneutralität, Selbstbestimmung) bestehen bleiben. Sie hängen nicht vom verwendeten Institutionenbegriff ab.