Krise: „[Eine] …Zeit, welche so offenbar die Grenze
ist zwischen zwei verschiedenen Ordnungen der Dinge“
Friedrich Schleiermacher (2016 [1799], S. 149)
Wenn, wie der deutsche Philosoph Friedrich Schleiermacher einmal schrieb, eine Krise die Zeit zwischen zwei Ordnungsweisen ist, dann erleben wir gegenwärtig womöglich eine einschneidende Neuordnung des Journalismus. Geschrumpfte Einnahmen in digitalen Medien, eine große Abhängigkeit von Plattformen und Technologieunternehmen, aber auch die sogenannte Vertrauens- und Autoritätskrise sind Anzeichen dieses Umbruchs. Die gegenwärtigen Pläne der DuMont Mediengruppe, alle Regionalzeitungen zu verkaufen, sind da nur eine Hiobsbotschaft.
Die Blaupause für einen zukunftsfähigen Journalismus in digitalen Medien ist nicht in Sicht. Schon der Blick auf die Gründerzeit der privatwirtschaftlich organisierten Massenpresse in Deutschland zwischen 1870 und 1900 unterstreicht aber, dass sich seine Neuordnung kaum am Reißbrett wird planen lassen. Damals war es eine neue Generation von Verlegern, die mit der seinerzeit vorherrschenden Partei- und Konfessionspresse brachen und durch ihr Unternehmertum, durch Wagemut und Experimentiergeist die prägenden Voraussetzungen für die Ausdifferenzierung und Professionalisierung des modernen Journalismus in Deutschland schufen.
Weder war von Anfang an entschieden, welche Inhalte der Massenpresse Erfolg bescheren sollten, noch welche Erlösquellen oder Organisationsmodelle sich als tragfähig erweisen würden. Auch heute deutet vieles darauf hin, dass die Neuordnung des Journalismus im Digitalen nur in kollektiver Praxis, experimentell und durch einen schrittweisen Prozess der Erprobung verwirklicht werden kann.
Große Erwartungen an Neugründungen
Doch wer könnte Treiber dieser Entwicklungen sein? Schon damals, im 19. Jahrhundert, waren es vor allem neue, unabhängig von etablierten publizistischen Strukturen entstandene Medien, die den Wandel vorantrieben. Dementsprechend groß sind heute die Erwartungen an journalistische Gründungen wie Mediapart in Frankreich, De Correspondent in den Niederlanden und Krautreporter in Deutschland. Unlängst betonte gar der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, Mathias Döpfner: „Ich glaube, was wir gerade erleben, ist eine Gründerwelle völlig neuer Medienunternehmen. Die meisten der traditionellen Medienunternehmen werden in ein paar Jahrzehnten verschwunden sein. […] Es wird eine völlig neue Generation von Medienunternehmen entstehen.“
Wie in so vielen Branchen werden auch im Journalismus allerlei überzogene Hoffnungen auf Start-ups und Gründungen projiziert: Sie sollen innovative Finanzierungsmöglichkeiten erschließen, verlorengegangene Leser:innenschichten wieder für den Journalismus begeistern, Arbeitsweisen abseits der traditionellen Redaktion erproben.
In der Tat können Neugründungen ein Labor für neue Lösungen bilden, da sie sich schon am Markt von den etablierten Medien differenzieren müssen, in ihrer Innovationsentwicklung aber nicht von bestehenden Unternehmenstraditionen oder einem engen Branchendenken eingeschränkt sind. Noch dazu können sie zu Trendgebern und Prototypen für die ganze Medienbranche werden, wenn sich die von ihnen erprobten Neuerungen in Produkten, Organisationsformen und Erlösmodellen als marktgängig erweisen und traditionelle Anbieter diese kopieren.
Erhebliche Hürden und Herausforderungen
In der Praxis tun sich viele der journalistischen Gründungen hingegen schwer. Die Forschung zeigt, dass die neuen Verlegerinnen und Verleger außerordentlich komplizierte Startbedingungen vorfinden. Unter den zahlreichen Herausforderungen sticht in Deutschland insbesondere der Mangel an solider Initial- und Anschubfinanzierung hervor, auf deren Grundlage ihre Experimente sozial verträglich abgebildet werden könnten.
Der Aufbau von Reichweite, die Gewinnung von (zahlenden) Nutzerinnen und Nutzern und – allem voran – die Herstellung qualitätvoller Inhalte lässt sich nicht mit Bordmitteln finanzieren. Zur Veranschaulichung: Die überaus erfolgreiche französische Gründung Mediapart, 2007 von vormaligen Le Monde-Redakteuren gestartet, benötigte in ihrer Anfangsphase fast sechs Millionen Euro Anschubfinanzierung. Die Gründer hatten sich gewaltig verkalkuliert, mehrfach mussten sie weitere Investoren gewinnen, die Gelder nachschossen.
Auch in Deutschland berichten Journalismusgründer, wie sie nur knapp an der Insolvenz vorbeischliffen. Die schwierige Finanzierungssituation trifft selbst diejenigen, die aus dem Journalismus kein Geschäft machen und in der laufenden Finanzierung auf Spenden oder Stipendien setzen; auch sie benötigen eine Startfinanzierung für den Aufbau ihrer gemeinwohlorientierten Journalismusprojekte.
Keine Frage: Unternehmerinnen und Unternehmer müssen ein mögliches Scheitern stets einkalkulieren. In vielen Branchen fallen sie jedoch vergleichsweise weich, da der Zugang zu Kapital leichter ist und private Verschuldung vermieden werden kann. Nicht so im Journalismus: Privatwirtschaftliche Kapitalgeber – etwa sogenannte Accelerator-Programme, die Gründungen in frühen Entwicklungsphasen finanziell und beratend unterstützen – legen einen deutlichen Fokus auf Technologieunternehmen. Diese sind gegenüber journalistischen Gründungen weit weniger personalintensiv und versprechen insgesamt größere Wachstumschancen und Veräußerungsgewinne.
Auch die Investitionen traditioneller Medienhäuser fließen im digitalen Bereich verstärkt in medienferne, nicht-journalistische Geschäftsfelder. Etwa die von Mathias Döpfner geführte Axel Springer SE betätigt sich zunehmend außerhalb des traditionellen Geschäft mit journalistischen Inhalten und hat, wie der Medienökonom Frank Lobigs in einer Studie schreibt, mit ihren Online-Rubrikenmärkten „ein neues Kerngeschäft gefunden“. Hinzu kommen die Vorstöße, die Krise des Journalismus durch Umwegsubventionen wie ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverlage zu lösen, mit denen potenziell große Kollateralschäden verbunden sind.
Bliebe noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk: Er hätte die Chance, sich als Partner, Unterstützer, mithin sogar Organisator einer journalistischen Gründungslandschaft in Deutschland, die ja durchaus Public Value stiftet, zu positionieren. Die entsprechenden Vorschläge liegen auf dem Tisch, doch die Öffentlich-Rechtlichen ziehen sich scheinbar auf die Position zurück, mit dem Start ihres Jugendangebots funk, das ja als „Content-Netzwerk“ in der Tat vieles vorwegnimmt, sei das Innovationssoll der nächsten Jahre einstweilen erfüllt.
Unterstützung für journalistische Experimente
Gründerinnen und Gründern im Journalismus bleibt zumeist nichts anderes, als sich „am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen“, also eine Finanzierung zu stemmen durch die zumeist geringen Einnahmen, die das Geschäft anfangs abwirft. Andere Quellen sind – wenn denn vorhanden – Eigenkapital oder Crowdfunding-Kampagnen, deren Unterstützer dann ganz überwiegend wieder die eigenen Kolleginnen und Kollegen sind.
Wenige institutionelle Alternativen bestehen: In Bayern organisiert die Bayerische Landeszentrale für neue Medien gemeinsam mit dem Staatsministerium für Digitales, Medien und Europa eine Anschubfinanzierung im „Media Lab Bayern“, in dem Raum für Trial-and-Error-Prozesse im Journalismus eröffnet werden soll. In Nordrhein-Westfalen hat „Vor Ort NRW“ der Landesanstalt für Medien einen Fokus auf die Unterstützung regionaljournalistischer Neugründungen. Auch wenige Stiftungen (z.B. die August-Schwingenstein-Stiftung oder die Schöpflin-Stiftung) engagieren sich und unterstützen vereinzelt journalistische Projekte. Eine Studie von Lutz Frühbrodt zeigt aber, dass in Deutschland gerade einmal 85 von gut 22.000 Stiftungen die Förderung des Journalismus als Ziel haben.
Das ist zu wenig. Dafür spricht auch, dass die US-amerikanischen Digitalunternehmen Google und Facebook in den letzten Jahren mit millionenschweren Förderinitiativen für digitalen Journalismus gestartet sind. (netzpolitik.org berichtete.) Sie, deren Dominanz im digitalen Medienmarkt gerade von Presseverlagen regelmäßig beklagt wird, zählen mittlerweile zu den größten Finanziers der journalistischen Gründerlandschaft in Deutschland. Welch eine Ironie.
Wie weiter?
Allein vor diesem Hintergrund ist es wünschenswert und notwendig, die Anschubfinanzierung für journalistische Gründungen in Deutschland zu verbessern. Dabei sind verschiedene Akteure gefragt:
- Die private Pressewirtschaft sollte ihre publizistische Verantwortung, die sie in gesellschaftlichen Debatten regelmäßig für sich reklamieren, auch durch die Förderung journalistischer Innovationen außerhalb der Grenzen der eigenen Organisation wahrnehmen.
- Stiftungen sollten ihre Kräfte bündeln und gemeinsam Gelder in einen Start-up-Fonds für journalistische Experimente einbringen. Die Grundlagen hierfür sind gelegt, u.a. durch den schon seit 2015 tagenden „Expertenkreis Qualitätsjournalismus“ im Bundesverband Deutscher Stiftungen.
- Forschung und Lehre an Hochschulen sind aufgerufen, sich verstärkt mit den gründungsbezogenen Herausforderungen des Journalismus auseinanderzusetzen und stärker auf „Media Entrepreneurship Education“ zu setzen. Sie sollten angehenden Medienschaffenden verdeutlichen, welche Potenziale (aber auch Risiken) mit Neugründungen verbunden sind.
- Die Medienpolitik ist gefordert, nicht bestehende Wertschöpfungsstrukturen durch Gesetzgebung zu konservieren, sondern vielmehr vorwärtsgerichtete Rahmenbedingungen und staatsfern organisierte Transformationshilfen zu schaffen. Wenn der Journalismus eben jenen vielfach beschworenen Eckpfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens bildet, dann rechtfertigt dies spezifische Förderlinien für die Branche, ähnlich etwa der Energiewirtschaft. Die Landesmedienanstalten, das zeigen die Beispiele aus Bayern und Nordrhein-Westfalen, können dabei eine wichtige Mittlerfunktion einnehmen.
Natürlich kann es nicht darum gehen, Gründungen dauerhaft an den Tropf institutioneller Förderer zu hängen. Vielmehr sollten finanziell abgesicherte Experimentierräume und Reallabore geschaffen werden, in denen hoffnungsvolle Gründungen neue Produkte, Erlösquellen und Arbeitsweisen über das notwendige Zeitfenster erproben können, bis sie im Erfolgsfalle auf eigenen Beinen stehen.
Hierzu bedarf es der Einsicht, dass nicht alle Experimente glücken werden. Branchenübergreifend – und das heißt auch in Sektoren mit eingespielten Geschäftsmodellen – scheitern etwa die Hälfte aller Gründungen während der ersten sechs bis sieben Jahre. Die Finanzgeber müssen sich darüber bewusst sein, dass sie Risikokapital investieren. Die Alternative aber wäre, dass publizistische Experimente zum Wohle des Journalismus und unserer Gesellschaft zu häufig in der Insolvenz oder privaten Verschuldung enden.

Christopher Buschow ist Juniorprofessor für „Organisation und vernetzte Medien“ an der Bauhaus-Universität Weimar, wo er schwerpunktmäßig zu Unternehmensgründungen in der Medienbranche forscht. Für seine Arbeiten wurde Buschow mit dem Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung und dem Niedersächsischen Wissenschaftspreis ausgezeichnet.




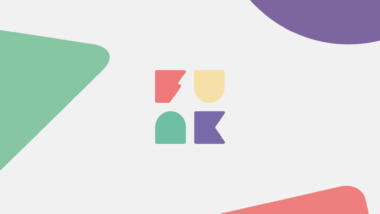
Frei verfügbare Informationsquellen sind ein Gebot des Grundgesetzes. Insofern können wir das nicht nur dem Markt überlassen. Leider glaubt das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten, dass freie Information nur von Rundfunkmolochen mit Ewigkeitsgarantie gewährleistet werden kann. Es sind die zunehmend irrsinnigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, die uns in die heutige Sackgasse geführt haben.
Unser öffentlich-rechtliches Mediensystem muss radikal umgebaut werden. Statt einer Rundfunkgebühr muss es künftig eine Mediengebühr geben. Diese sollte an alle Anbieter fließen, die gewissen Qualitätskriterien genügen. Die Entscheidung, an welche Anbieter die Gelder gehen, sollten die Gebürenzahler treffen, meinetwegen alle 5 Jahre.
Wichtig sind Vielfalt und Dynamik. Kein Anbieter kann sich auf Ewigkeitszahlungen verlassen.
Dann hat auch Qualitätsjournalismus wieder Zukunft.
Die journalistischen Neugründungen in der deutschen Gründerzeit brachen keineswegs mit der Partei- und Konfessionspresse, aber durch den 1871 im Deutschen Reich eingeführten Urheberrechtsschutz und die Berner Übereinkunft von 1886 bekamen die Verleger endlich Rechtssicherheit über das Eigentum an den von ihnen veröffentlichten Werken [https://de.wikipedia.org/wiki/Berner_%C3%9Cbereinkunft_zum_Schutz_von_Werken_der_Literatur_und_Kunst]. Bis dahin konnte praktisch jeder Interessierte sich ein Werk nehmen und es unter eigenem Namen und zum eigenen Gewinn veröffentlichen.
Etablierte publizistische Vertriebsstrukturen in nennenswertem Maßstab gab es im Deutschen Reich vor dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht, will man von der lokalen Verbreitung etwa um Leipzig oder Wien herum oder der hyperlokalen von Journalen „für die gebildeten Stände“ durch Auslage in Gast- und Kaffeehäusern absehen. Erst mit der zunehmenden Mobilität stieg das Interesse der Bevölkerung an Nachrichten und damit die Abonnentenzahl und der Aufbau von Vertriebsnetzen.
Auch Ende des 19. Jahrhunderts gab es aus dem Verkauf der in den besseren Kreisen verbreiteten Journale bereits genügend Erkenntnisse darüber, was „zieht“: Auch damals schon verkauften sich Mord, Sex und Rührseligkeit bestens. Einziger Hemmschuh war die Zensur, die besonders den liberaleren Blättern zu schaffen machte.
Schon dieser kleine Ausschnitt aus der Entwicklung zeigt, dass das in-Umlauf-bringen von Journalismus immer eine Frage der Anpassung war, während die Inhalte gleich blieben. Wer diese Anpassung verpasst, hat schlechtere Chancen als die, die rechtzeitig reagieren.
Dazu gehört etwa das Haus Axel Springer, das bereits im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts den Umbau vom Zeitungsverlag zum Multimediakonzern zielstrebig und erfolgreich betrieben hat:
„Wenn man sich Springers Beteiligungen ansieht, entsteht das Bild einer zielgerichteten, absolut zukunftsfähigen Aufstellung jenseits von Print.
Beteiligungen an Immonet, Mein Gutscheincode oder der 100-prozentige Besitz von StepStone sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Löwenanteil aus Rechten an Fernsehsendern, Radiostationen, Sportberichterstattung und Medien-Dienstleistungen besteht. Damit beweist Springer erheblichen Weitblick: Print wird zwar nicht gleich morgen sterben, aber auch nicht mehr wachsen – also sichert man sich rechtzeitig Geschäftsfelder, die künftiges Wachstum versprechen und den massenmedialen Einfluss Springers weiter stärken werden.“
(von 2013)
Die große Erwartung an journalistische Gründungen besteht in dem wachsenden Bedarf an unabhängiger Berichterstattung in einer Zeit der Vereinnahmung des Journalismus durch Politik und Marketing. Doch niemand kann erwarten, dass aus über mehr als ein Jahrhundert bewusst abgegrenzten Geschäftsmodellen in Zeitungsjournalismus, Rundfunkjournalismus, Fernsehen und Forschung in wenigen Jahren zukunftsfähige und auch noch Gewinn versprechende neue Strukturen entstehen. Dabei ist ein nationales Modell, das europäischen Anforderungen genügt, noch gar nicht auf dem Tisch. Der eben stattfindende Kampf um ein neues, alle Sparten gleichzeitig fair vertretendes Urheberrecht gibt eine erste kleine Kostprobe davon.
Vielen Dank für den Beitrag. Diesen Aspekt hatte ich bei der Mediendiskussion der letzten Tage nicht mit auf der Agenda. Aber letztendlich landet auch Christopher bei meiner Kernfrage: Wie schaffen wir es (nach der Anschubfinanzierung) guten Journalismus zu finanzieren? Wofür ist die breite Masse der Menschen (die man zur Finanzierung benötigt) bereit, Geld zu bezahlen? Werbung wollen wir ja nicht und so ein Gema-/GEZ-Modell wird sicher auch nicht funktionieren, da wahrscheinlich wie bei der Gema das Geld bei den Großen hängen bleibt.
Was mir bei den ganzen Neugründungen aber auffällt und was imho sicher auch ein Grund dafür ist, dass sie keine große Verbreitung finden: Einer der größten Kritikpunkte aktuell ist ja die Vermischung von Meinung und Fakten in Nachrichten. Aber jede neue Medienseite, die ich in den letzten Jahren besucht habe, war Meinung pur. Ist ja schön, da ich sie oft teile. Aber für einen objektiven Blick auf die Welt stehen solche Angebote halt auch nicht.
Wenn ich z.B auf einem neuen Portal (aus Hannover kam das glaub) Texte von Journalisten aus der ganzen Welt abrufen (und bezahlen) kann finde ich das Klasse. Korruption in Myamar, Umweltzerstörung in den USA, IT-Buden in Kenja … spannend. Drei Artikel aus Deutschland gab es. Zwei zur Geschlechtergerechtigkeit (m/w) und einen dritten zum d-Geschlecht. Sorry. Da fällt mir nichts mehr ein. So wird das sicher nichts.
Der Journalismus ist abhängig von der technischen Möglichkeit eine verbraucher- oder lesefreundliche Plattform zu etablieren, in der der Leser für gut befundene Artikel o. Recherchen ohne viel tamtam zu zahlen/ spenden bereit ist. Die meisten haben weder die Lust/ Zeit noch das geld viele teure paywalls parallel zu bezahlen. Spenden hat auch seine Grenzen, aber wenn Hunderttausende Menschen mitmachen, dürften auch paar Euros pro Person für ein Medienunternehmen nicht unerheblich sein.
Das führt zur Frage, wie man besonders der Jugend und den Heranwachsenden verklickert, dass ohne Journalismus die Welt sehr düster sein würde, und der Journalismus eine unterstützenswerte Arbeit ist.
Die Antwort ist irgendwo da draußen :)