Angefangen hat alles lange vor meiner Zeit bei netzpolitik.org. Ich arbeitete noch an der Uni und mir wurde ein zentimeterdicker Umschlag überreicht, darin Dokumente verbunden mit der Frage, ob ich mich beim Bundesverfassungsgericht sachverständig äußern würde. Es war der Fragenkatalog zur Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung, also zur Massenüberwachung von Telekommunikationsdaten.
Plötzlich ging es um die gesamte Bevölkerung
Ich habe mich davor viel mit Biometrie befasst, also Verfahren, die menschliche Körpermerkmale vermessen und analysieren. Es gab dabei ein paar Aspekte, die auch Massenüberwachung betreffen. Die Idee, alle erwachsenen Menschen anlasslos biometrisch zu erfassen, ist ein bisschen älter noch als die Idee der massenhaften Erfassung von Telekommunikationsdaten.
Aber bei der Vorratsdatenspeicherung war es gewissermaßen holistisch: Es ging plötzlich um die gesamte Bevölkerung und nicht nur um einen Anteil. Außerdem war es die erste wirklich in der breiten Öffentlichkeit geführte Debatte um technisierte Massenüberwachung, die häufig in den Nachrichten vorkam.
Die Menschen gingen wieder auf die Straße
In der Zeit vor der Bundestagswahl 2009 wurde das Thema zum Politikum, stärker als zuvor. An den Protesten der Freiheit-statt-Angst-Demos beteiligten sich damals auch die politischen Parteien – außer die CDU.
Das Beschwerdeverfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung war die zahlenmäßig größte Verfassungsbeschwerde, die die Bundesrepublik je gesehen hatte. Es brachte sehr viel Aufmerksamkeit für die Umsetzung der Idee, die gesamte Bevölkerung in ihrem Kommunikationsverhalten zu erfassen. Das erschien vielen damals unglaublich monströs. Das ist heute vielleicht nicht mehr unbedingt so, man ist diese Forderung mittlerweile gewöhnt.
Aber damals dachten viele: Wenn sie das durchkriegen, dann können sie auch andere anlasslose große Datensammlungen durchsetzen. Das ist ein Dammbruch. Und die Tatsache, dass Speicher billiger werden und dass die Software, mit der man solche Daten analysiert, einfacher verfügbar und auch mächtiger in ihren Funktionen wird, war damals schon absehbar.
Wenn man sich heute durchliest, was zum Beispiel in der damaligen Stellungnahme (pdf) steht, aber auch in anderen, die Sachverständige dort abgegeben haben, dann sieht man, dass technische Entwicklungen, die sich danach gezeigt haben, schon prognostiziert wurden.
Ein Kampf über ein Jahrzehnt
Als es losging in der mündlichen Verhandlung zur Verfassungsbeschwerde und in der Zeit, bevor das Urteil kam, war die Hoffnung groß, dass das Gericht dem Vorhaben eine wirklich harte Grenze setzt – dass sie entscheiden, diese Form von anlassloser Massenüberwachung ist mit unserer Verfassung letztlich nicht zu vereinbaren. Wir haben natürlich gefeiert, als das Urteil kam: Nicht nur, dass die Vorratsdatenspeicherung unrechtmäßig war und verfassungswidrig, sondern auch, dass die Daten sofort gelöscht werden mussten. Für so gefährlich hat das Gericht diese Idee gehalten. Es war ein großer Erfolg.
Aber die kleinen Türen, die dabei offen blieben, sind als viel größer interpretiert worden, vor allem politisch. Das liegt auch an der EuGH-Rechtsetzung, denn der Europäische Gerichtshof verfügte in seinen letzten Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung zwar, dass man so eine riesenhafte anlasslose Datensammlung auf das unbedingt Notwendige beschränken müsse. Eine Ausnahme wären aber zum Beispiel konkrete terroristische Gefahrensituationen. Nun fangen die ersten Regierungen an zu sagen: Wir könnten uns eigentlich eine beständige Terrorismusgefahr hindefinieren. Wir müssen das nur juristisch so fassen, dass wir die Vorratsdatenspeicherung dann trotzdem umsetzen können.
Es hat sich eine Selbstverständlichkeit eingeschlichen, mit der die Vorratsdatenspeicherung immer wieder gefordert wird. Staatliche Massenüberwachung ist mittlerweile in gestandenen Demokratien ein Standard-Forderungskatalog-Element in konservativen Kreisen, das von der absoluten Ausnahme zu einer normalen politischen Forderung verkommen ist. Gegen diese Normalisierung der Massenüberwachung muss man sich wehren, sonst wird sie alltäglich.
Wir bleiben dran
Fast 1.000 Artikel zur Vorratsdatenspeicherung. Unterstütze uns!
Gezielte statt anlassloser Überwachung
In Deutschland war und ist der Treiber für Massenüberwachung das Bundesinnenministerium, aber in Teilen auch das Bundeskanzleramt. Es geht ja nicht nur um die Interessen der Polizei, sondern auch um die Interessen der Geheimdienste. Bei den Behörden besteht der Wunsch, möglichst alle Daten bekommen zu können, die möglich sind. Das ist vielleicht verständlich aus Sicht der Verbrecherjagd. Und wenn, um eine Straftat aufklären zu können, nun mal Millionen andere Datensätze aufgezeichnet werden müssten, dann nehmen das manche in Kauf.
Doch der Kampf gegen Massenüberwachung darf nicht als Gegnerschaft von Kriminalitätsbekämpfung oder von individuellen Überwachungsmaßnahmen umdefiniert werden. Tatsächlich ist es ein Kampf gegen anlassloses milliardenfaches Wegspeichern von Daten über Menschen.
Manche Leute scheinen zu denken: Ja, was habt ihr denn gegen Verbrechensbekämpfung? Die Antwort ist einfach: nichts, im Gegenteil. Denn oft ist die Idee, sich technisch von einer Massenüberwachung zu verabschieden, damit verbunden, qualitativ bessere Verfahren einzuleiten, die individualisiert überwachen und wirklich was nutzen. Alternativvorschläge, gerade auch bei der Vorratsdatenspeicherung, gehen genau in diese Richtung: nicht alle und jeden überwachen, sondern sich darauf konzentrieren, wie man mit technischen Mitteln Verbrechensbekämpfung sinnvoll betreiben kann.
Fakt ist: Wenn jemand einer Straftat konkret verdächtigt ist, haben Ermittler heute alle Möglichkeiten bei technischen Überwachungsmaßnahmen. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung. Denn eine individuelle technische Überwachungsmaßnahme ist eben nicht anlassloses Überwachen von allen.
Im Analogen inakzeptabel, im Digitalen Normalität
Im Digitalen scheint einiges anders als in der analogen Welt. Denkt man an einen alten Krimi in vordigitalen Zeiten: Niemand wird auf die Idee kommen, dass ein Kommissar in den Siebzigern überhaupt den Gedanken haben würde, dass er tagelang unterm Sofa von zig Leuten liegt und deren Leben belauscht.
Es hat sich aber heute bei vielen so festgesetzt, dass digitalisierte Informationen zugänglich sein müssen. Doch wir haben auch eine höchstpersönliche Ebene bei diesen Daten. Und wir brauchen ein neues Konzept von Privatsphäre und auch von Intimsphäre, denn das ist im Digitalen noch nicht gut geklärt. Ansonsten werden wir in einer massenhaft überwachten Gesellschaft landen, aus der wir nicht mehr herausfinden.
Das Denken, dass es keine Form von Kommunikation geben darf, in die man nicht potenziell reinhören kann, hat sich verbreitet. Das ist neben der eigentlichen Idee der Vorratsdatenspeicherung eine Art schwerer Kollateralschaden. Die aktuelle Idee der Chatkontrolle, was auch eine Form der Massenüberwachung ist, spricht Bände darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit und in welchem Ausmaß etwas gefordert wird, was die Kommunikation von vielen Millionen Menschen betrifft. Es ist fast unerklärlich, wie wenig reflektiert dabei über das Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre hinweggegangen wird.
Wir müssen uns nicht dafür rechtfertigen, Grundrechte zu haben
Diejenigen, die massive Einschränkungen von Grundrechten fordern, müssen dafür gute Gründe vorlegen. Haben sie keine oder keine evidenzbasierten, dann darf man nicht in die Defensive rutschen. Die Grundrechte sind uns quasi geschenkt worden, glücklicherweise. Wir müssen uns nicht dafür rechtfertigen, sie auch in der Praxis umgesetzt sehen zu wollen.
Ich wehre mich auch gegen den Begriff Abwehrkampf. Faktisch ist es natürlich einer, da die immer wiederkehrende Forderung etwa nach einer Vorratsdatenspeicherung auch juristisch immer wieder abgewehrt werden muss. Aber in Wahrheit sollte sich niemand dafür verteidigen müssen, dass er ein Grundrecht auch ausübt. Dafür besteht kein Rechtfertigungsdruck. Denn alle, die diese Grundrechte einschränken wollen, müssen dafür ordentliche Gründe vorbringen. Und sie müssen Argumente haben und nicht nur Sockenpuppen oder Anekdoten.
Privatsphäre als Störfaktor
In den vergangenen Jahren kam in Deutschland eine Entwicklung hinzu, die in die Richtung geht, Datenschutz als den ewigen Hemmschuh, als Innovationshindernis, als Verkomplizierung oder als alles drei hinzustellen. Dieses Framing hat enorm zugenommen. Privatsphäre ist dann kein zu schützendes Grundrecht mehr, das mit dem Kern der Menschenwürde in Verbindung steht, sondern ein bloßer Störfaktor.
Trotzdem gilt generell, dass politische Debatten bei uns in Deutschland auch dadurch gekennzeichnet sind, dass Datenschutz zumindest mitgedacht wird. Und wir von netzpolitik.org haben auch einen Anteil daran. Es gibt eben eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der wir das ansprechen können, mit der wir auch von einer Community getragen werden. Wenn sich keiner dafür interessieren würde, könnten wir nicht existieren. Und ich höre häufig aus anderen Ländern, dass sie sich so eine Plattform wie netzpolitik.org wünschen würden, allein schon, um Debatten anzustoßen und weiterzuführen.
Beispielsweise das deutsche Urteil zur Vorratsdatenspeicherung war eine international beachtete Entscheidung. Dass vom Gericht ein Pflock eingehämmert wurde, hat nicht nur die deutsche politische Debatte verändert.
Fast 1.000 Artikel zur Vorratsdatenspeicherung
Wir werden ganz sicher nicht aufhören, weiter über technisierte Massenüberwachung zu berichten. Wir sind da Überzeugungstäter. Wir haben über die Jahre fast eintausend Artikel allein zur Vorratsdatenspeicherung angesammelt. Das ist natürlich auch ein Zeichen, wie wichtig wir das Thema immer wieder nehmen. Und wir haben eine Expertise angehäuft, die man anderswo nicht hat. Damit ist nicht nur die Technik an sich gemeint, sondern zum Beispiel auch politische Abläufe und Absprachen, juristische Feinheiten, die mit der Technik zusammenhängen, oft auch die politische Gemengelage – und was etwa argumentativer Bullshit ist, der trotzdem immer wiederholt wird.
Ich würde mir wünschen, dass Menschen gegen Massenüberwachung wieder auf die Straße gehen. Aber die Situation in Deutschland kommt derzeit solchen Protesten nicht entgegen: Die Leute haben einfach andere Probleme, die finanzielle Situation und natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Ich kann verstehen, dass für viele Menschen Überwachung aktuell nicht das drängendste Problem ist. Doch die Freiheit von Überwachung, insbesondere von dauerhafter anlassloser Massenüberwachung, bleibt letztlich die Voraussetzung für politische Veränderung: Eine überwachte Gesellschaft kann sich nur schwer ändern, sie erstarrt.
Der Text basiert auf einem Gespräch, das Stefanie Talaska geführt und aufbereitet hat.
Kommt mit uns in den Maschinenraum von netzpolitik.org: In sieben Videos und persönlichen Einblicken zeigen wir euch, mit welchen Prinzipien und mit welchen Mitteln unsere Redaktion arbeitet.

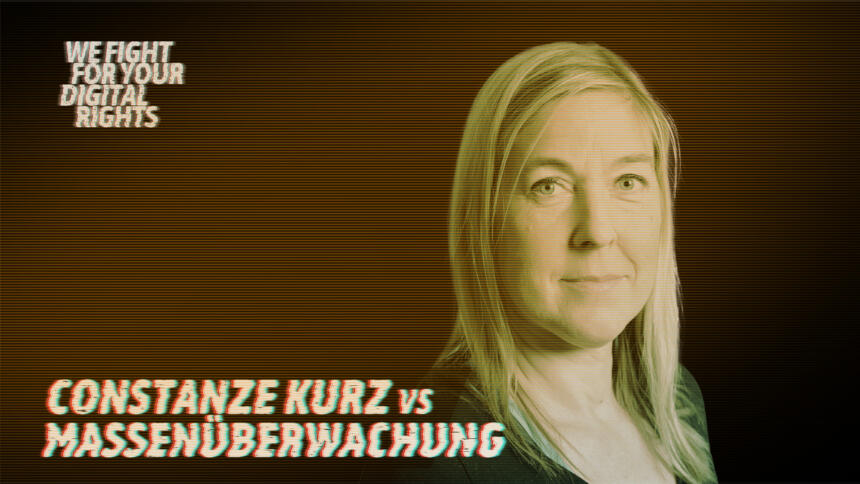



Zunächst ganz, ganz, ganz vielen Dank für Deine und Eure Arbeit. Ich bin unglaublich froh, dass es Leute und eine Institution wie Euch gibt, die sich die Kompetenz und Reichweite erarbeitet haben, um gesellschaftlich etwas bewirken zu können.
.
Nun habe ich aber eine Frage, die mir tatsächlich bisher niemand erklären konnte.
Wie Du oben schreibst, muss es natürlich eine Technologie geben, mit der man unter bestimmten, klar definierten Voraussetzungen Verdächtige und deren Kommunikation überwachen kann. Sei es das Telefonabhören früher oder die gesamte Online-Kommunikation heutzutage. Aber dazu braucht es eben einen Anlass. „Quickfreeze“ wäre ein mögliches Modell dafür. QF ist per Definition keine anlasslose Überwachung.
Ja, selbst unter extremeren Umständen, zB wenn es zuverlässige Hinweise gäbe, dass ein großer Terroranschlag in einer Stadt unmittelbar bevor stünde, aber man nicht genau weiss, wo, könnte ich nachvollziehen wenn zB die Kommunikation aller Menschen eines Stadtteil für eine sehr eng begrenzte Zeit nach Stichworten durchsucht würde. Aber auch hier gäbe es einen Anlass.
Meine Frage: Warum können sich die höchsten Gerichte nicht dazu durchringen, ein absolutes, ausnahmsloses Verbot einer *anlasslosen* Massenüberwachung bzw Vorratsdatenspeicherung auszusprechen? Quickfreeze & Co wären doch davon gar nicht betroffen? – Ich weiss, dass Du keine Juristin bist, aber vielleicht gibt es in Eurer Redaktion jemand, um zur Antwort beizutragen.
Vielen Dank im Vorraus. :)
„muss es natürlich eine Technologie geben, mit der man unter bestimmten, klar definierten Voraussetzungen Verdächtige und deren Kommunikation überwachen kann“
Nein, muss es natuerlich nicht. Das ist eine freie Entscheidung unter Abwaegung der Vor- und Nachteile und kein wie in „muss“ implizierter Zwang.
Es muss diese Technologie genauso wenig geben wie es Folter geben muss.
@ Günni
Also der EuGH hat einer anlasslosen* Massenüberwachung klar eine Absage erteilt und die Vorratsdatenspeicherung auf die absolut notwendigen Merkmale begrenzt. Entlang dieser „Leitplanken“ wird das federführende BMI einen Gesetzesentwurf vorlegen.
Leider hat das BMJ durch sein vorschnelles Handeln den diesjährigen Wettbewerb im „Referenten-Entwurfs-Mikado“ verloren und wird nur noch eine untergeordnete Rolle spielen dürfen.
Die aktuelle Version der TR TKÜV Ausgabe 8.1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/OeffentlicheSicherheit/Ueberwachung_Auskunftsert/node.html#FAQ1064496
ist ein echter Informationsgewinn. und als Stichtag zur Umsetzung ist wohl der 1.12.2023 bestimmt.
Hallo, Günni,
ich bin Jurist und denke, ein Stück der von Dir erbetenen Auskunft steht bereits in Deiner Fragestellung drin. „Warum können sich die höchsten Gerichte nicht dazu durchringen…“ – Gerichte können aus Gründen der Gewaltenteilung immer nur die ihnen vorgelegten Fälle und Fallfragen beantworten, sonst handeln sie selbst quasi „anlasslos“. Wenn also ein Fall nur zu 99 Prozent schlimm ist, kann das Gericht nur sagen: „Dieser Fall ist schlimm.“ Es darf aber eigentlich nicht sagen: „Alle Fälle, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen, sind schlimm.“ Manche Gerichte tun das trotzdem. Das nennt sich „obiter dictum“ und die Methode wird dadurch gerechtfertigt, dass ein Gericht in Urteil A ankündigt, wie es vermutlich in den vorhersehbaren Fällen B bis F entscheiden wird, um unnötige künftige Gerichtsverfahren einzusparen. Aber ein „obiter dictum“ ist dennoch notwendig unverbindlich, weil es eben nicht die Fallfrage behandelt.
Eventuell sollten wir froh sein, solange kein Gericht über eine tatsächlich vollkommen anlasslose Massen-Vorratsdatenspeicherung entscheiden muss…
Freundliche Grüße von Alphonse Alpaka.
In der aktuellen Situation bestimmt der Überwachungskapitalismus wer wofür auf die Straße geht und wer jetzt welche Überzeugungen hegt.
Zumindest bei den meisten. Wir müssen uns erst mal eingestehen das dieses Konzept gescheitert ist und uns für die nächsten Jahrzehnte erneut mit zusätzlicher Bildung aufstellen. Aktuell verhält es sich so, das alle Bürger:innen diesen Status verlernt haben, es ist als fallen sie alle zurück in den Analphabetismus. Möglich war es nur weil die aktuellen vernetzten Geräte die Menschen eben viel stärker analysieren und personalisiert informieren als es ein Überwachungsstaat kann.
Solange wir als Gesellschaft uns dies nicht bewusst sind, macht es keinen Sinn sieben Layer höher eine politische Entscheidung für Alltagsregeln durch zu setzen welche jedem Menschen in unserem Land einen möglichen besseren Status einräumt.
Natürlich sieht sich unsere digitale aufgeklärte Elite stark von dieser Massenüberwachung bedroht, weil wir aktuell vor den Überwachungskapitalisten nicht bedroht sind. Dennoch, ich denke die Gesellschaft fällt auch nach der Massenübwachung zurück auf persönliche Kommunikation, wie zu Zeiten der DDR.
Das große Problem bei der Überwachung, ist nicht die Überwachung an und für sich. Es ist die indirekte Legitimierung für alles, was daraus folgt und im Besonderen beim Überwachungskapitalismus, die Wette eines Algorithmus – mit dem Ziel Verhalten in Zukunft richtig vorher zu Bestimmen aufgrund einer eingeleiteten Bewussten Verhaltensänderung durch unbekannte Dritte.
Der Verlust der eigenen Daten, Geräte und Kontrolle spielt dabei in etwa die selbe Rolle wie die Notwendigkeit sich mit dem Internet zu verbinden oder einen Computer für alltägliche Bedürfnisse nutzen zu müssen.
Foul am Rande: und wobei früher alles besser war, werden einige Analysten nicht Müde zu sagen, dass es eben jene Boomer waren, die den jetzigen Generationen die Chancen vermiest habem. Aktiv, nicht aus Versehen.
Ich bin dankbar, dass es Menschen wie euch gibt, die für die Freiheit auch an dieser Front kämpfen, und das vor allem (mutmaßlich) nicht gesteuert durch irgendwelche Lobby-Seilschaften oder -Geldflüsse. Allerdings ist über die Jahre meine Gegnerschaft hinsichtlich digitaler Überwachung etwas gebröckelt, und das (soweit ich es beurteilen kann) nicht durch Propaganda, sondern durch profundes Nachdenken.
Nahezu jedes Werkzeug in den falschen Händen kann auch als Waffe dienen. Je mächtiger das Werkzeug, desto mächtiger die Waffe. Und freiheitlich denkende Menschen wissen glaube ich, dass die Lösung nicht sein kann, alle Werkzeuge zu verbieten. Im Fall der Kommunikation und deren Überwachung darf man glaube ich nicht den Fehler machen, ausschließlich einen (/unseren) Staat als möglichen Täter zu sehen, auch wenn Staaten natürlich schon in zahllosen Fällen so aufgetreten sind, siehe der Deutlichkeit halber zum Beispiel China. Tatsächlich haben mächtige Werkzeuge die kaum ausweichbare Tendenz, dass sich nach Macht strebende Menschen und Organisationen ihrer bemächtigen, und diese als Waffe benutzen wollen. Das können religiöse und politische Extremisten sein, wirtschaftliche Akteure, das organisierte Verbrechen (worunter man vermutlich auch Pädos rechnen könnte), externe Staaten, oder natürlich der eigene Staat.
Die Frage ist für mich daher, ob man vor diesen Machenschaften lieber die Augen verschließen möchte, weil man sich denkt „so nett wie ich sind alle“, oder ob man nicht eher das Maximum über freiheitsfeindliche Aktivitäten aller Couleur herausfinden, und diese transparent der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte. Falls letzteres der Fall ist, sollte man sich fragen, ob man an den Regeln, nach denen das zu geschehen hat, mitwirken will, oder das lieber anderen (und damit möglicherweise wieder Mitgliedern einer Täterklasse) überlässt.
Hi Oliver,
nun es ist eine Frage über Wissen, Technik und letztendlich die Intelligenz der Menschen, welche sich über ihr Handeln bewusst sind. Es ist eben wie beim Lesen, Rechnen oder eben der Möglichkeit eine Fremdsprache zu beherrschen und über Grenzen hinweg zu handeln.
Wie bei einer artifiziellen Intelligenz, oder eben einem nötigen Schwellwert einer Schwarmtheorie, sind bestimmte Summen zu bilden um hinreichend Neuronen zu überreden einen Impuls zu Feuern um eine bestimmte wichtige Handlung anzustoßen. Es ist im großen wie im Kleinen, die Lösung einer Gleichung über unterschiedliche Summanden hinweg.
Problem dabei: Wenn die Rechnung am Ende bekannt ist, fällt es leicht bestimmte Spielregeln aufzustellen, eine bestimmte Sichtweise zu fokussieren oder an zu regen, die sich dann durch setzt. Wir haben es in der Wirtschaft öfters erlebt, in der Politik oder bei dem Streit um ein Frühstücksei. Es spielt keine Rolle wer welchen Charme, Beziehungen oder finanzielle Mittel eingesetzt hat. Entscheidend ist leider nur das Ergebnis.
Ich würde mich in einer aufgeklärten, für Künste, Kultur oder Wissen interessierten Gesellschaft mit ähnlichen Moralvorstellungen dennoch glücklicher Schätzen an dieser Bewegung teil zu haben als in einem Überwachungs- oder Polizeistaat.
Warum mich das ganze gerade so wurmt? Die Abhängigkeit von Informationen und dem Internet und dort erlebten Verhaltens, hat den Status von einer Sektengemeinschaft auf Drogen, da einzelne Menschen heraus zu ziehen und aus zu nüchtern ist wirklich schwierig, weil die anderen diese Sucht als Normalzustand verstehen.
Als Gegenseite: Es ist ein bisschen wie: Alle sind schlank, essen Gesund selbst gekochtes, treiben Sport und leben in einer Glücklichen Gesellschaft zusammen.
„…die in die Richtung geht, Datenschutz als den ewigen Hemmschuh, als Innovationshindernis, als Verkomplizierung oder als alles drei hinzustellen.“
Man kann wohl kaum bestreiten, dass das der Fall ist. Nur ist das kein unangenehmer Nebeneffekt, sondern es geht doch genau darum, dass mit perönlichen Daten nicht leichtfertig umgegangen wird. Ja, das SOLL hemmen, es SOLL das leichtfertige Herumwerfen mit Daten verkomplizieren, es SOLLEN Innovationen, die auf der unangebrachten Verwendung persönlicher Daten basieren, daran gehindert werden. Deshalb verstehe ich nicht, dass das hier als „Framing“ hingestellt wird, so als sei das nicht der Fall.
Wie wäre es stattdessen, wenn erklärt wird, warum genau das notwendig und gerechtfertigt ist?
Man sollte aber auch ehrlich genug sein, um zuzugeben, dass der Umgang mit dem Datenschutz teilweise seltsame Blüten trägt. Das ist zum Glück nur ein kleiner Teil der Fälle, aber darum gibt es dann zu Recht auch Aufregung. Auch das ist dann aber berechtigt und kein Framing.
Nachtrag zu meinem Kommentar an Oliver:
Ich denke wir können ein Ziel erreichen wo wir aufgeklärt agieren, einander vertrauen und nicht durch Technik oder Algorithmen gegeneinander ausgespielt werden.
Wenn es die Gesellschaft verbietet -wie in China, oder den unaufgeklärten Industrienationen-, können wir diese Art zu Leben über einen zusätzlichen Layer teilen, wie damals eine Religion, oder Philosophie dennoch durchsetzen.
Liebe Constanze,
vielen Dank für Dein unermüdliches Engagement in der Sache.
Was mich an den Debatten um das Thema allerdings auch stört, ist das immer so getan wird als müsse man hier innere Sicherheit gegen Freiheitsrechte abwägen. Wir brauchen m.E. auch viel mehr öffentliche Diskussion darüber, wie wirksame Polizeiarbeit funktioniert und dass ein Anhäufen von mehr Daten nicht nur keinen Nutzen hat, sondern häufig kontraproduktiv ist.
Ob 9/11 oder Breitscheidplatz, es waren relevante Informationen im Vorfeld gegeben, die niemand ausgewertet hat.
Dass die Vorratsdatenspeicherung jetzt nicht mehr wegen Terrorismus sondern Kindesmissbrauch gefordert wird, ändert daran nichts.
Mein Lieblingszitat eines Bekannten: die Suche nach der Nadel im Heuhaufen wird nicht einfacher wenn man die Menge an Heu erhöht. Und nein, da hilft auch kein Machine Learning.
Bei Grundrechtseingriffen muss nicht nur die Schädlichkeit betrachtet werden, sondern auch die Wirksamkeit und diese im Vergleich zu Alternativen. Letzteres fehlt mir zu häufig in der Argumentation
H.,
vorweg ein toller Beitrag. Aber ich denke leider, werden die Machine-Lerning Algorithmen mit der Datenmenge schon besser. Natürlich gibt es weiterhin Fehler, aber es könnte eine Zeit kommen wo diese Netze und Algorithmen Menschen überholen. Wenn wir sehr viel Pech haben liegt diese Zeit in der Vergangenheit.
Ein Kind hat keine Chance gegen einen Computer, den es in seiner oder ihrer Tasche trägt und die Informationen des Menschen zum lernen nutzt, oder um Verhalten vorher zu sagen und sogar zu beeinflussen.
Computer haben kein Problem mit Nadeln und Heuhaufen. Weil die Daten auf der Clientseite ausgewertet werden, im Treiber der Kamera oder des Mikros, verknüpft mit einem digitalen Elfen in Form einer digitalen Magd oder eines digitalen Butlers.
Der Kampf um digitale Rechte, findet auf den Endgeräten statt. Wenn die halt nicht schon jetzt open Source sind, sondern Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft oder Tennet, Bytedance und so weiter. Haben wir den Kampf schon verloren bevor wir gestartet sind.
Hier eine Studie über Demokratie, im Kampf gegen den Überwachungskapitalismus:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/26317877221129290
P.s.: Ich denke nicht die Polizisten oder unser Staat sind die Gegner. Weil wir aktuell noch eine Demokratie sind. Ich denke wir haben nur ein Problem der IT und wir müssen uns Menschen, als auch unsere Demokratie zumindest darauf vorbereiten.