Das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) in Bayern führt eine Fülle an hochkomplexen technologiebasierten Ermittlungsansätzen ein. Diese sollen – so verspricht es die bayerische Landesregierung – die Gefahrenabwehr dem neuesten Stand der Forschung und Technik anpassen und für mehr Sicherheit sorgen. Das Polizeigesetz soll schon morgen im bayerischen Landtag von der CSU-Mehrheit beschlossen werden. Zu den geplanten Maßnahmen gehören auch die sogenannten Erweiterten DNA-Analysen. Wie wir in diesem Text zeigen wollen, steckt die umstrittene Technik allerdings noch in der Entwicklungsphase. Ihr bald wohl flächendeckender Einsatz lässt viele Fragen offen und birgt große Risiken.
Die Erweiterten DNA-Analysen sollen es in Zukunft ermöglichen, aus genetischen Spuren eines Unbekannten Rückschlüsse auf dessen äußere Merkmale wie Augen-, Haar- und Hautfarbe zu ziehen. Das nennt man „DNA-Phänotypisierung“. Zum anderen zählt zur Erweiterten DNA-Analyse auch die Analyse der „biogeographischen Herkunft“, vom englischen Fachbegriff „biogeographical ancestry“, kurz BGA. Viele der Befürworter meinen fälschlicherweise, die Technologie erlaube es, Aussagen über die Ethnie einer von der Polizei gesuchten Person zu machen.
Die umstrittenen Techniken könnten bald nicht nur in Bayern zum Einsatz kommen. Im Sommer 2017 brachten Bayern und Baden-Württemberg im Bundesrat eine gemeinsame Gesetzesinitiative zur Zulassung erweiterter DNA-Analysen für die Strafverfolgung (§ 81e StPO) in den Bundesrat ein. Damals sahen die anderen Bundesländer jedoch noch weiteren Beratungsbedarf. Auf Initiative der Union wurde die Einführung der DNA-Phänotypisierung inzwischen im Koalitionsvertrag (S. 124) von Unionsparteien und SPD festgeschrieben.
In Bayern sollen die Erweiterten DNA-Analysen künftig bei drohender Gefahr eingesetzt werden. Der bayerische Innenminister Joachim Hermann nannte als Anlassfall etwa eine mögliche Bombenbastler-Werkstatt, in der eine DNA-Spur gefunden wird, die einem (potentiellen) Bombenleger (d. h. einem möglichen Gefährder) zugeordnet wird. Mit der Genanalyse soll sich flugs dessen Aussehen und Herkunft feststellen lassen. Allerdings sprechen zahlreiche wissenschaftliche Argumente gegen den effizienten und verantwortungsvollen Einsatz Erweiterter DNA-Analysen in der polizeilichen Arbeit.
Spiel mit der Wahrscheinlichkeit
Die Befürworter der Erweiterten DNA-Analysen argumentieren mit außerordentlich hohen Vorhersagegenauigkeiten: Augenfarbe 90-95%, Haarfarbe 75-90%, Hautfarbe 98%. Die „kontinentale BGA“ wird gar bei 99,9% eingestuft. Diese Angaben finden sich auch in den Gesetzesanträgen von Baden-Württemberg und Bayern für eine entsprechende Änderung der Strafprozessordnung sowie in einer Expertise des Bundeskriminalamtes für die Innenministerkonferenz vom Sommer 2017. Für die Vorhersage der Pigmentierung, also der Hautfarbe, bezieht man sich dabei auf eine Überblicksstudie (Kayser 2015); für die der BGA auf eine Stellungnahme der Spurenkommission von Dezember 2016.
Die disziplinübergreifende Wissenschaftsinitiative STS@Freiburg hat diese übertrieben hohen Wahrscheinlichkeitsangaben seit März 2017 mehrfach kritisiert: Zum einen wurden in der Überblicksstudie von Kayser (2015) nur summarische Wahrscheinlichkeitswerte (sogenannte AUCs, „areas under the curve“) berichtet, die die Vorhersagegenauigkeit belegen sollen. Für die Ermittlungspraxis viel relevanter sind jedoch prädiktive Werte, da diese die Wahrscheinlichkeit abschätzen, mit der eine Person braune Augen hat, tatsächlich braune Augen hat, wenn die Methode braune Augen vorhergesagt hat – die Technik kann nämlich auch irren. Für prädiktive Werte ist entscheidend, wie häufig ein bestimmtes Merkmal in der Bevölkerung ist; er ist also populationsabhängig und kann viel niedriger als der AUC sein. In der Tat berichtete eine Studie aus dem Frühjahr 2017, die die Vorhersagegenauigkeit in acht verschiedenen europäischen Ländern testete, dass die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Vorhersage brauner Augenfarbe in den nördlicheren Ländern trotz sehr hoher AUCs unter 70% liegt.
Entsprechend stellte ein Aufsatz von Caliebe, Krawczak und Kayser Ende 2017 fest, dass sowohl das Grundlagenverständnis in Bezug auf äußere Merkmale als auch die Vorhersagemodelle „noch unvollständig“ seien. Die Autoren schlussfolgern, dass für jedes Merkmal sowie für jede Ausprägung eines Merkmals, für jedes Vorhersagemodell und jede Zielpopulation noch weiterführende empirische Grundlagenforschung durchgeführt werden müsste, bevor die DNA-Analysen „sinnvoll in Ermittlungsverfahren eingesetzt“ werden können.
Zudem berichten die zentralen Studien von Kayser und seinen KoautorInnen, dass sämtliche Wahrscheinlichkeitswerte schlechter ausfallen, wenn es sich um „gemischte“ Ausprägungen eines Merkmals handelt: Nur sehr helle und sehr dunkle Farben werden gut vorhergesagt.
Minderheiten im Visier
Im Anwendungsfall würden solche gemischten genetischen Ausprägungen in Deutschland meistens bedeuten, dass das Analyse-Ergebnis für die Ermittlungen nutzlos ist: Entweder deutet die DNA-Analyse auf einen hell pigmentierten Europäer hin – dann gibt es davon zu viele, um sinnvoll Prioritäten für die Ermittlungen zu setzen. Oder es deutet auf einen „gemischt-pigmentierten“ Menschen, z. B. mit mittelbraunen Haaren und grünen Augen hin – dann ist aber die Vorhersagegenauigkeit zu schlecht.
Nur wenn das Ergebnis auf eine dunkel pigmentierte Person hinweist, können Ermittler in Deutschland weitere Ermittlungsschritte anschließen. Der damit verbundenen Gefahr der Diskriminierung und Stigmatisierung – etwa durch Anschlussmaßnahmen wie DNA-Reihenuntersuchungen oder eine entsprechende Öffentlichkeitsfahndung – sind sich ExpertInnen im Ausland sehr bewusst. Bei den politischen Entscheidungsträgern und Polizeivertretern, die die Einführung Erweiterter DNA-Analysen in Deutschland vorantreiben, scheint diesbezüglich kaum ein Problembewusstsein vorhanden zu sein. Zumindest haben sie sich bisher öffentlich nicht dazu geäußert, wie sie mit dieser grundlegenden Problematik umzugehen gedenken.
Begrenzte Aussagekraft
Die Analyse der sogenannten „bio-geographischen Herkunft“ ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zuverlässig möglich. 99,9% Vorhersagegenauigkeit in Bezug auf die kontinentale Herkunft werden nur dann erreicht, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Erstens, die Analyse berücksichtigt DNA-Sequenzen aus verschiedenen Quellen des Spurenlegers. Die menschliche Erbinformation verteilt sich in der Zelle auf verschiedene DNA-Moleküle: Im Zellkern finden sich die beiden Geschlechtschromosomen (X und Y) und die 22 Paare der Autosomen, dazu kommt ein kleines DNA-Molekül in den Mitochondrien. In Großbritannien ist es forensische Praxis, für eine valide Analyse Daten aus allen diesen Quellen zu kombinieren. Währenddessen halten es Experten in Deutschland für ausreichend, Aussagen nur auf die Verwendung einer der verschiedenen DNA-Moleküle zu stützen, obwohl dies unter Umständen zu irreführenden Ergebnissen führen kann.
Zweitens, die Vorfahren der gesuchten Person dürfen ausschließlich aus einer bestimmten Region stammen; d. h. Personen, die einen „gemischten“ Hintergrund haben, wie GenetikerInnen sagen, sind nicht verlässlich zuzuordnen. Drittens, es müssen bereits andere Menschen mit derselben BGA in der Referenzdatenbank enthalten sein. Keine der öffentlich zugänglichen DNA-Referenzdatenbanken enthält weltweit repräsentative DNA-Proben. Der Nahe und Mittlere Osten sind in relevanten Datenbanken besonders schlecht repräsentiert. Weiter ist das Ergebnis einer erfolgreichen BGA-Analyse im Ermittlungsfall von umstrittenen Nutzen, da sich daraus nur sehr begrenzt Aussagen über das Aussehen eines DNA-Trägers und keine direkte Aussage über seine ethnische Zugehörigkeit, seine Staatsangehörigkeit oder seinen Geburtsort treffen lassen. Davon gehen jedoch irrtümlicherweise nicht nur viele Laien, sondern auch zahlreiche Polizeivertreter, politische Entscheidungsträger, Journalisten und wissenschaftliche Experten in Deutschland aus.
Genetische „Phantombilder“: zu hohe Erwartungen
Obwohl viele Innenpolitiker es wiederholt behauptet haben: Die Erweiterten DNA-Analysen können keine genetischen Phantombilder erzeugen, darauf hat bereits letzten Sommer der Leiter der gemeinsamen Spurenkommission, Prof. Peter Schneider hingewiesen, der die Abteilung für Forensische Molekulargenetik am Institut für Rechtsmedizin der Uni Köln leitet. Allenfalls könnte man diskutieren, inwiefern sie für die Erstellung eines „genetischen Steckbriefs“ taugen. Den Unterschied zwischen „Phantombild“ und „Steckbrief“ sollte man in der öffentlichen Kommunikation auf jeden Fall beachten und nicht den Eindruck erwecken, dass technisch schon viel mehr möglich sei, als die Methode in Wirklichkeit hergibt.
Fehlende Einsatz-Statistiken
In einigen Fällen in den Niederlanden und in Spanien, wo Erweiterte DNA-Analysen zugelassen sind, haben diese entscheidende Hinweise für Ermittlungen zu schweren Straftaten geliefert. Bisher gibt es jedoch keine statistischen Angaben darüber, in wie vielen Fällen insgesamt Erweiterte DNA-Analysen in der Verbrechensaufklärung eingesetzt wurden. Damit bleibt die für die rechtliche Abwägung der Verhältnismäßigkeit zentrale Frage offen, in welchem Verhältnis die „erfolgreichen“ zu den „nicht erfolgreichen“ Fällen stehen, sprich: In wie vielen Fällen der Einsatz erweiterter DNA-Analysen die Ermittler vorangebracht hat und in wie vielen der Einsatz der Technologie keinen Beitrag zur Aufklärung geleistet hat.
In Deutschland führte die Technik in einem wichtigen Fall die Ermittler sogar in die Irre und verzögerte damit tragischerweise seine Aufklärung. Der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn wird heute der rechtsextremen Terrorgruppe NSU zugeschrieben. Doch u.a. wegen Angaben zur biogeografischen Herkunft, die auf eine mögliche Herkunft der mutmaßlichen Täterin „aus der Russischen Förderation oder angrenzenden Gebieten“ hinwiesen, suchten die Beamten lange fälschlicherweise nach einer Täterin aus einer osteuropäischen Roma-Familie.
Zuverlässige Einsatzstatistiken über die Technologie fehlen bisher – selbst in Ländern, in der diese rechtlich zugelassen ist. Doch nun sollen trotzdem politische Entscheidungsträger beurteilen, ob die immensen Kosten für die Technologie, die Schulungen für Kriminalbeamte, Staatsanwälte und Richter sowie der gravierende Eingriff in Grundrechte und Datenschutz, die mit Erweiterten DNA-Analysen einhergehen, in einem angemessenen Verhältnis zur Effizienz der Technologien stehen.
Externe Labore im Einsatz
Offen bleibt in Bayerns neuem Polizeigesetz, wie auch in den anderen Gesetzesanträgen, wer die Erweiterten DNA-Analysen durchführen soll. Bereits jetzt leidet in der forensischen Molekularbiologie die universitäre Ausbildung und Forschung darunter, dass in Deutschland Aufträge für DNA-Analysen, die von den Kriminaltechnischen Instituten der Landeskriminalämter mengenmäßig nicht bewältigt werden, über offene, europaweite Ausschreibungen vergeben werden. Dabei werden meist kommerzielle Anbieter bevorzugt, die aus vielerlei Gründen kostengünstiger arbeiten.
Sollten in Zukunft die Landeskriminalämter und kommerzielle Institute die Erweiterten DNA-Analysen durchführen, hat dies weitreichende Folgen. Zum einen würde sich dadurch das technologische Gefälle zwischen DNA-Forensik in den Ermittlungsbehörden sowie kommerziellen Laboren einerseits und den rechtsmedizinischen Instituten an den Universitäten andererseits vergrößern. Wegen der begrenzten Investitionen der Hochschulen würden diese endgültig den Anschluss verlieren. Zum anderen stellt sich die Frage, wie eine Qualitätskontrolle dieser wissenschaftlich äußerst voraussetzungsreichen Analytik gewährleistet werden soll, da hiermit auch die Entstehung einer der DNA-„Geheimwissenschaft“ an den Kriminaltechnischen Instituten und den kommerziellen Instituten droht. Deren Wissen ist dann der allgemeinen Forschung nicht zugänglich und somit auch der Überprüfung durch die kritische Selbstkontrolle der wissenschaftlichen Community entzogen.
Einseitige Expertise
Mit der einseitigen Expertise, auf die sich sämtliche Gesetzesänderungen zur Einführung der Erweiterten DNA-Analysen stützen, wird ein Grundprinzip demokratischer Legitimation für die politische Entscheidungsfindung verletzt. Wie etwa Hannah Arendt 1964 in einem Interview argumentierte (1:04:20-1:06:18 min), müssen sich Politiker bei Entscheidungen über komplexe Sachverhalte, die sie selbst nicht vollständig überblicken, notgedrungen auf Expertisen stützen. „Jeder vernünftige Staatsmann“, sagte Arendt, „holt sich entgegengesetzte Expertisen ein, denn er muss die Sache ja von allen Seiten sehen. Dazwischen muss er urteilen und [darin] äußert sich der Gemeinsinn.“ Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass politische Entscheidungen, die sich auf derartig einseitige Expertisen stützen wie im vorliegenden Fall, nicht dem Gemeinsinn verpflichtet sind.
Die Befürworter Erweiterter DNA-Analysen führen als zentrales Argument oft an, das Recht müsse dem wissenschaftlichen Fortschritt angepasst werden. Mit den seit Dezember 2016 aufgeworfenen offenen Fragen und Kritikpunkten der Wissenschaft und Fachwelt haben sie sich offensichtlich kaum auseinandergesetzt. In Bezug auf das PAG in Bayern stellt sich somit die Frage, ob das bayerische Innenministerium einfach nur versäumt hat, seine wissenschaftlichen Hausaufgaben zu machen, oder ob hier – unter dem Deckmantel einer behaupteten Wissenschaftlichkeit – Erwartungen in der Bevölkerung geweckt werden, um möglichst rasch ein weitreichendes Ermittlungsinstrument zu etablieren. Dies vermag zwar einer verunsicherten Bevölkerung und unter Druck stehenden Ermittlern viel zu versprechen, ist aber momentan weder wissenschaftlich ausreichend validiert noch rechtlich verantwortungsvoll reguliert.
Unter diesen Voraussetzungen sind Ermittlungsfiaskos, die enorme Kosten und Zeit verschlingen werden, nicht zu vermeiden. Für solche Fehler wird allerdings, gerade aufgrund der hohen Erwartungen, nicht besonders viel Verständnis in der Bevölkerung zu erwarten sein. Dasselbe gilt freilich auch, wenn die Ermittler schwierig zu deutende Ergebnisse erhalten und diese unberücksichtigt lassen: Die Bevölkerung wird nach der übertriebenen Darstellung der Technologien in der Öffentlichkeit kaum verstehen, weshalb die Erweiterten DNA-Analysen oft auch unzuverlässige Ergebnisse liefern.
Aufruf zur Verantwortung
Dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann die vielfältige, differenziert vorgebrachte Sachkritik am PAG seit Beginn der Debatte pauschal als „Lügenpropaganda“ diffamiert, ist zutiefst besorgniserregend. Das gilt gerade für uns als Angehörige der wissenschaftlichen Community. Angesichts der Komplexität der neuen Technologien und ihrer Anwendungen und angesichts der absehbaren, weitreichenden gesellschaftlichen Auswirkungen darf über die Einführung der Erweiterter DNA-Analysen nicht überhastet entschieden werden – und nicht unter dem Druck populistischer Stimmungsmache. Für eine verantwortungsvolle Regulierung braucht es Zeit, eine vielfältig aufgestellte wissenschaftliche, juristische und ethische Expertise, die Einbeziehungen von erfahrenen ExpertInnen aus dem Ausland sowie einen konstruktiven, sachorientierten und praxisübergreifenden Austausch. Sollte der bayerischen Staatsregierung also an einer umsichtigen Regelung gelegen sein, die sich nicht an überzogenen Kontrollfantasien und einseitigem parteipolitischen Kalkül ausrichtet, sondern dem Gemeinwohl der bayerischen Bevölkerung verpflichtet ist, tut sie gut daran, die Novelle des PAG nicht wie vorgesehen am 15. Mai zu verabschieden, sondern diese sorgfältig zu überarbeiten.
Prof. Dr. Anna Lipphardt ist Kulturanthropologin, Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber Statistiker und Prof. Dr. Veronika Lipphardt Wissenschaftsforscherin, alle drei unterrichten und lehren an der Universität Freiburg. Matthias Wienroth ist Postdoc Fellow am Policy, Ethics & Life Sciences Research Centre der Newcastle University (UK). Die AutorInnen sind Mitglieder der interdisziplinären Wissenschaftlerinitiative STS@Freiburg (https://stsfreiburg.wordpress.com/), die sich seit Dezember 2016 für einen differenzierten Umgang mit erweiterten DNA-Analysen in der Polizeiarbeit einsetzt. Eine Kurzfassung dieses Gastbeitrags erschien auf Focus Online.


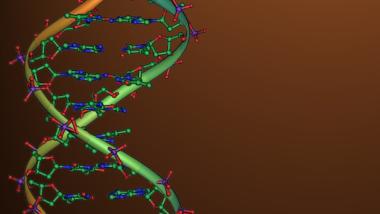
Danke für diesen Artikel. Sehr erhellend.
Ich sehe allerdings, vor der Frage der technischen Umsetzbarkeit, als wesentlichen ersten Kritikpunkt die nicht ausreichend konkrete und geschärfte, ausformulierte Definition des Anwendungskriteriums „Drohende Gefahr“. Unabhängig davon ist der Begriff einer „drohenden“ Gefahr als äußerst gefährlich anzusehen.
Um dieses Kriterium zu erfüllen, reicht allein der unbegründete Verdacht aus, um einen oder mehrere Menschen der staatlichen Verfolgung auszusetzen. Mit den entsprechenden Folgen, die das, nocheinmal: durch eine bloße Verdächtigung, der daraus folgenden Eingriffe, in der Regel haben kann.
Das ist nicht nur persönliche Demütigung, der negative Einfluss auf das soziale Umfeld. Das kann auch den Verlust des Arbeitsplatzes, den Verlust der Wohnung, die Kündigung von Konten, Verlust der Arbeitsmittel, hohe Anwaltskosten und weiteres bedeuten.