Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung der FDP-Bundestagsfraktion zum Thema „Urheberrechte im Netz stärken“ (PDF der Einladung) durfte ich heute mit Dr. Bernhard von Becker vom C.H. Beck Verlag über das Wissenschaftsurheberrecht streiten. Im Folgenden das Manuskript meines Eingangsstatements.
Als Wissenschaftler an einer Universität komme ich in Forschung und in der Lehre mit dem Urheberrecht in Berührung – und in beiden Fällen sind damit Probleme verbunden. Heute möchte ich mich aber nur mit der Forschungsseite beschäftigen.
Lassen Sie mich kurz meine ganz persönliche Situation schildern. Als Juniorprofessur ist mein Vertrag befristet und wenn ich in der Wissenschaft bleiben möchte, ist das mit Abstand wichtigste, in begutachteten Fachzeitschriften zu veröffentlichen, die in Zeitschriftenrankings gut positioniert sind. Wenn ein Artikel nach mehrjähriger Arbeit und einem Begutachtungsverfahren, in dem FachkollegInnen meinen anonymisierten Beitrag und allfällige Überarbeitungen kostenlos begutachtet haben, endlich von einer solchen Zeitschrift zur Veröffentlichung akzeptiert ist, dann ist der letzte Schritt, dass ich ein Copyright-Formular ausfüllen und sämtliche Rechte an den Verlag abtreten muss. Selbstverständlich ohne Vergütung.
In letzter Zeit haben sich diese Formulare aber geändert. Man muss dort ankreuzen, ob man für die Forschung von bestimmten Einrichtungen in den USA oder Großbritannien Geld bekommen hat, die zu einer Open-Access-Veröffentlichung verpflichten. In so einem Fall machen die Verlage die Artikel nämlich frei online zugänglich. Leider konnte ich bislang so ein Kästchen noch nie ankreuzen.
Nach Gesprächen mit unzähligen Kollegen verschiedenster Fachbereiche und eigener interdisziplinärer Forschung zum Thema (PDF) wage ich zu behaupten: Mein Fall ist kein Sonderfall sondern typisch für die große Mehrheit der Sozial- und Naturwissenschaften. Vor allem in den Geisteswissenschaften gibt es noch Felder mit dominanter Buchkultur, wo die Situation etwas anders aussieht. Welche allgemeinen Schlüsse lassen sich daraus für das Wissenschaftsurheberrecht ziehen?
A) Im Markt für wissenschaftliches Publizieren haben wir es mit Marktversagen zu tun
Überwiegend öffentlich finanzierte Forschung wird von öffentlich finanzierten Wissenschaftlern kostenlos begutachtet und dann von Verlagen, deren Leistung in der Regel aus Lektorat, Satz und Distribution besteht, für teures Geld an öffentlich finanzierte Bibliotheken zurückverkauft. Für die großen Wissenschaftsverlage wie Elsevier und Taylor Francis sind auf diese Weise enorme Margen zu verdienen – mein österreichischer Kollege Gerhard Fröhlich spricht von “Gewinnraten wie im Waffen- und im Drogenhandel” (PDF).
Und das ist auch nicht verwunderlich: Wollen WissenschaftlerInnen Karriere machen, müssen sie in den wenigen Top-Journalen publizieren, und wollen Universitäten in einem bestimmten Bereich forschen, müssen ihre Bibliotheken eben diese Top-Journale abonnieren. Deshalb hat der Verlag sowohl gegenüber den AutorInnen als auch gegenüber den Bibliotheken enorme Verhandlungsmacht. Und wenn ein Verlag für Texte und Begutachtung nichts zahlen muss und gleichzeitig Monopolpreise verlangen kann, dann sind enorme Renditen kein Zufall sondern Ergebnis von Marktversagen. Denn zu Top-Journalen werden diese durch die Reputation ihrer AutorInnen und ihrer wissenschaftlichen HerausgeberInnen, nicht durch den Verlag.
Dass es problemlos anders gehen könnte, beweist der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. Sein offizielles Journal „Business Research“ ist Open Access online verfügbar. Sämtliche Beiträge sind doppelt-anonym begutachtet. Finanziert wird es aus Mitgliedsbeiträgen, die sich auf 80 Euro jährlich belaufen, sowie einer Anschubfinanzierung durch die DFG.
B) Als öffentlich finanzierter Forscher möchte ich zu Open Access gezwungen werden
Im Unterschied zu anderen Urheberrechtsbereichen ist in der Wissenschaft das Verwertungsproblem bereits gelöst. Wissenschaft wird zu größten Teilen öffentlich finanziert, um die Freiheit von Forschung und Lehre sicherzustellen. Als Wissenschaftler muss ich deshalb meine Ergebnisse nicht ökonomisch verwerten, um Erfolg zu haben. Im Gegenteil, wissenschaftlicher Erfolg bemisst sich daran, wie einflussreich Ideen in der wissenschaftlichen Community und darüber hinaus sind. Es geht also darum, so viel wie möglich gelesen und zitiert zu werden.
Wenn aber meine Forschungsergebnisse hinter Paywalls von Verlagen versteckt sind, dann bedeutet das, dass viele Universitäten keinen Zugriff darauf haben – von der außeruniversitären Öffentlichkeit ganz zu schweigen. Und ich rede hier nicht nur von Universitäten in ärmeren Ländern, deren ForscherInnen natürlich ganz besonders davon betroffen sind. Ich kann nur berichten, dass ich jede Woche Anfragen von Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Österreich bekomme, ob ich nicht zufällig Zugriff auf diesen oder jenen Artikel habe und diesen nicht mailen könne.
Würden Forschungsförderungseinrichtungen wie die EU-Rahmenprogramme oder die DFG noch strengere Vorschriften für die Open-Access-Veröffentlichungen machen, die Verlage hätten keine andere Chance als sich diesbezüglich zu ändern. Die Open-Access-Regelungen der großen US-Forschungseinrichtung NIH zeigen, dass das machbar und sinnvoll ist. Derzeit werde ich von Verlagen gezwungen, ihnen sämtliche Rechte an meinen Forschungsergebnissen exklusiv einzuräumen. Lieber wäre es mir, ich wäre gezwungen meine Ergebnisse stattdessen frei online zugänglich zu machen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt.
C) Ein unabdingbares Zweitveröffentlichsrecht ist unabdingbar
Um zumindest die Möglichkeit zu haben, meine eigenen Artikel auf meiner eigenen Homepage bzw. im Repositorium meiner Universität digital zugänglich zu machen, bräuchte es dringend ein unabdingbares Zweitveröffentlichungsrecht. Und erfreulicherweise ist ein solches im aktuellen Gesetzesvorschlag zum Thema enthalten. Jedoch gibt es auch hier noch einige Schwachstellen. So ist die vorgesehene Embargo-Frist von einem Jahr für viele naturwissenschaftliche Bereiche, allen voran medizinische Forschung, definitiv viel zu lange. Auch ist es problematisch, wenn nicht die finale Fassung sondern nur die akzeptierte Manuskriptversion frei zugänglich gemacht werden darf. Auf diese Weise sind die Aufsätze nicht ohne weiteres zitierfähig, weil beispielsweise Seitenangaben fehlen und weil sich die akzeptierte Manuskriptversion im Zuge des Lektoratsprozesses in der Regel noch verändert. Warum gibt es erst eine Wartefrist, wenn danach trotzdem nicht das finale Dokument zugänglich gemacht werden darf?
Das größte Problem im vorliegenden Entwurf ist allerdings die Beschränkung des Zweitveröffentlichungsrechts auf Fälle von Forschung, die größtenteils öffentlich finanziert ist. Zwar ist die öffentliche Finanzierung ein wesentliches Argument für Open Access, es ist aber keineswegs das einzige. Und warum drittmittelfinanzierten ForscherInnen, die ihre Ergebnisse in denselben Journalen veröffentlichen wie ihre öffentlich finanzierten KollegInnen, nicht ebenfalls ein Zweitveröffentlichungsrecht zustehen sollte, ist nicht einsehbar. Das wäre es nur, wenn es sich nicht um ein Zweitveröffentlichungsrecht sondern um die im vorherigen Punkt angesprochene Zweitveröffentlichungspflicht handeln würde.
Wichtig ist mir schließlich noch zu betonen, dass selbst bei einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht noch keineswegs alles in Ordnung ist – im Gegenteil, es ist zu erwarten, dass dieses Zweitveröffentlichungsrecht von Verlagen als Argument für weitere Preissteigerungen herangezogen wird (vgl. die Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüterrecht für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den grundlegenderen Problemen des Entwurfs sowie einer Strategie, die nur auf Zweitarchivierung von wissenschaftlichen Aufsätzen abstellt). Mittel- und langfristig führt kein Weg daran vorbei, konsequent auf echte Open-Access-Zeitschriften zu setzen, wie es sie in manchen Feldern, zum Beispiel in Form der Public Library of Science, bereits gibt.

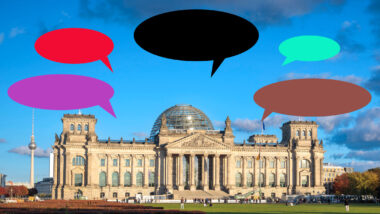

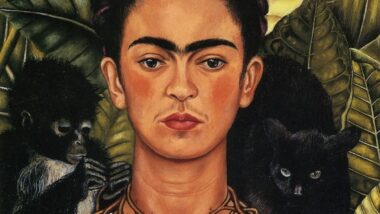
Eigentlich liegen alle Argumente auf der Hand. So lange die Infrastruktur da ist und die Papiere und Daten noch Checksummen etc. gegen Fälschungen/Versionierung bekommen, gibt es gar nichts was dagegen spricht. Alles andere wäre sogar eher unwissenschaftlich.
Es wäre zu schön um wahr zu sein. Selbst die Journals, die eigentlich zugänglich sein sollten, sind es oft wegen komplizierter Verifikationsverfahren, Inkompatibilität mit dem VPN der Uni oder anderweitiger technischer Schwierigkeiten doch wieder nicht.
Im grossen und Ganzen Zustimmung. Aber ‚der letzte Schritt, dass ich ein Copyright-Formular ausfüllen und sämtliche Rechte an den Verlag abtreten muss‘. So einfach ist das ja gar nicht. Man darf mit seinem Artikel meistens eine Menge-nur die endgueltige Version auf der Webseite frei verfuegbar machen nicht. Man kann teilen, pre-prints online stellen und institutionelle repositories gehen auch (zunehmend) und Derivate (Buchkapitel usw.) sind auch zulaessig. In vielen Faellen deckt das viele wissenschaftliche Alltagssituationen ab (Teilen der Forschung mit Kollegen, Lehre, Zugang zu einer Zusammenfassung etc. fuer den ‚Rest der Welt‘). Das soll das exorbitante Gewinnmodell der Verlage nicht verteidigen, aber es lohnt sich, das Kleingedruckte zu lesen und moeglichst breit zu interpretieren (das Verlage Autoren wegen copyright verklagen habe ich bisher nicht gehoert und die sind beim gegenwaertigen Klima sicher zurueckhaltend-Final pdf bei Academia.edu hochgeladen-zack, schon kommt Post vom Anwalt?!). Aber groessere Rechtssicherheit ist natuerlich wuenschenswert und der Weg zu Golden OA muss weiter beschritten werden. Am Ende wir sicherlich ein Kompromiss stehen. Z.B. verlangen die Verlage durch die Bank weg etwa $2500 fuer Open Access-es wird in der Zukunft eine Staffelung geben, die zwischen attraktiven science papern und sozialwissenschaftlichen Nischen die ‚keinen‘ interessieren unterscheiden. Kleinere Margen fuer Verlage, besserer Zugang fuer die Leute, aber im Prinzip wird das peer-review Modell erstmal bleiben…