Was ist eigentlich Internet Governance, und wieso müssen wir darüber reden? Wikipedia zitiert aus einem Bericht der Arbeitsgruppe Internet Governance von 2005:
Internet Governance „ist die Entwicklung und Anwendung durch Regierungen, den Privatsektor und die Zivilgesellschaft, in ihren jeweiligen Rollen, von gemeinsamen Prinzipien, Normen, Regeln, Vorgehensweisen zur Entscheidungsfindung und Programmen, die die Weiterentwicklung und die Nutzung des Internets beeinflussen.“
In jedem Fall eine Definition, die auch nach mehrmaligem Lesen nicht langweilig wird. Vielleicht liegt es ja an dieser aus Not geschaffenen Definition, die die Welt braucht, um weiter darüber zu streiten, wie Internet Governance ausgestaltet sein sollte, dass keiner so richtig weiß, was man wie lösen soll. Das an sich präsentiert einen guten Grund, einen weltweiten Multistakeholder-Dialog auszuloben, bei dem Vertreter aus Regierung, Zivilgesellschaft, von Unternehmen und der technischen und wissenschaftlichen Community ihre Meinung über die Zukunft der IG äußern können. Ende April fand die NETmundial in Sao Paolo statt (netzpolitik berichtete ausführlich), bei der sich am Schluss auf einen „rough consensus“ geeinigt wurde, also eine Art herrschende Meinung der Gruppe mit Enddokument.
Der EuroDIG in Berlin: Multistakeholder und Multimedia
Als kleiner Europäischer Fortsetzungsschnipsel dieser Konferenz trafen sich vergangene Woche die europäischen Multistakeholder in Berlin. Zwei Tage lang, am 12. und 13. Juni, spielte das Auswärtige Amt Lokalität für den Multistakeholder-Dialog EuroDig (European Dialogue on Internet Governance). Der ambitionierte Titel der Veranstaltung: „Digital society at stake – Europe and the future of the Internet“. Zwei Tage lang wechselten sich Panel, Workshops, Flash-Sessions und Socializing ab. Außenminister Steinmeier begrüßte die Gäste, das Eröffnungsplenum stand unter dem Thema: Roadmap for Internet Governance. Mit weitreichenden Bezügen zu den Beschlüssen der NETmundial sollten im Rahmen des Multistakeholerdialogs Anknüpfungen gefunden werden.
So sehr ich es schätze wenn möglichst multimedial (‚multi‘ ist ohnehin das Zauberwort) gearbeitet wird und es sowohl live-Untertitelung als auch eine sich ständig aktualisierende Twitterwall gibt, so ist das doch auch ein arger Angriff auf die Konzentrationsprioritäten. Was lese ich zuerst? Die spaßige Untertitelung mit Tippfehlern (Best: „University of Hell Zing Key), die retweetende Twitterwall, in der sich zumindest zu Beginn fast ausschließlich über die mangelnde Inklusivität und white-male-dominance beschwert wurde, ohne sich den Inhalten zu widmen – oder versucht man doch, die Sprecher zu verstehen? Was haben sie eigentlich gesagt? Ich höre Internet governance und lese ‚Weißer Anzugsträger‘. Ich höre Multistakeholer und lese ‚Wo sind die Frauen, wo ist die Jugend, wer hat diese Zusammensetzung zu verantworten?‘.
@JohnSilvanos University of Hell Zing Key :) #eurodig pic.twitter.com/yBXNPRoWsY
— Marlene Scherf (@laney_ms) 12. Juni 2014
Vielleicht ist das eine Opening-Plenary-Krankheit, wie auch der Veranstalter versuchte zu erklären: Man sucht sich vor allem Repräsentanten, die gewichtige Positionen innehaben, und rahmt das Thema mit ein paar wohlklingenden Phrasen. Sowohl Inhalte als auch Inklusivität sind in pompösen Begrüßungsrunden einfach überbewertet. Und die Moderatorin war ja gut, und eine Frau: Jeanette Hoffmann stellte unbequeme Fragen, auf die sie keine Antworten bekam, zum Beispiel, wie man eigentlich echten Einfluss erlangen könnte, nicht nur Texte die weitere Texte zum Thema beeinflussen die sich dann auf weitere Texte beziehen? Kleines Highlight: Zur Eröffnung gab es im Publikum einen Stummen Protest für Snowden:
Activists protest in silent for Snowden at the opening speech at #Eurodig pic.twitter.com/TvTelYrADF — Katitza Rodriguez (@txitua) 12. Juni 2014
Wann wurde das Öffentliche privat?
Die größere Hoffnung waren sowieso die Workshops, und die haben mich nicht enttäuscht. When did the public sphere became private? Zu der spannenden Frage äußerten sich Rikke Frank Jorgensen vom Dänischen Institut für Menschenrechte, iRights-Anwalt Till Kreutzer, Annette Mühlberg von ver.di und Minka Stoyanova (Fulbright Fellow). Drei Frauen, ein Mann und eine Moderatorin (Gry Hasselbalch), alle Gender-Quoten-Nörgler hatten jetzt gar keine andere Wahl als zuzuhören, was wirklich gesagt wird. Moderatorin Hasselbalch wünschte sich für die Diskussion eine Zusammenstellung der Herausforderungen für die ‚public sphere‘, die öffentliche Sphäre, die immer mehr privatisiert wird. Anette Mühlberg von ver.di wies darauf hin, man müsse sich bewusst machen, was eine fehlende Privatsphäre für den Bürger bedeutet. Bestehende Rechte müssen in technische Anforderungen übersetzt werden. Sie forderte ein Recht auf Privatsphäre und Anonymität, Privatsphärewerkzeuge für Bürger, Offene Regierung/Verwaltung und Risikoabschätzungen für sogenannte Smartcities. Till Kreutzer von iRights eröffnete den prägnanten Gegensatz zwischen ‚open‘ vs. ‚proprietary‘ (also ‚closed‘) auf der einen und ‚public vs. private‘ auf der anderen Seite. Seiner Meinung nach liegt die Problematik darin, dass alle Open-Initiativen (wie Open Data, Open Source etc) auf Freiwilligkeit basieren – wer sich nicht öffnen will, wird das auch nicht tun. Das kann aber das öffentliche Interesse beschneiden. Manche offene Datenbanken sind unter Umständen nur zur privaten Nutzung kostenfrei, was bedeutet, dass eine Urheberrechts-Schicht um öffentliche Informationen gelegt wird. Kreutzer zufolge hat copyright bei öffentlichen Informationen nichts verloren, und diese in dem Sinne private Aneignung öffentlicher Informationen müsse gestoppt werden. Mühlberg machte daraufhin geltend, dass öffentliche Dienste durchaus Geld kosten würden, auch im digitalen Zeitalter, und dass der Debatte Ehrlichkeit über den Einfluss von Geld fehle. Man brauche Richtlinien für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, um den Einfluss des Geldes zu beschränken.
Rikke Frank Jorgensen sieht das ähnlich: Wenn immer mehr private Organisationen das Internet beherrschen, so muss sichergestellt werden, dass diese sich an grundlegende Normen wie Menschenrechte halten, was sich vor allem über mehr Transparenz verwirklichen ließe. Auf eine Frage der Workshopteilnehmer, wieso denn das Private im Internet so einen Unterschied mache – auch im realen Leben gebe es ja keinen reinen ‚public space‘, überall wäre privater Kontext dabei – entgegnete sie mit dem Unterschied zwischen der physischen und virtuellen öffentlichen Sphäre: Im physischen Raum kann man sich theoretisch versammeln, oder handeln, ohne dass etwas aufgezeichnet wird. Im virtuellen Raum hinterlässt man immer Spuren, die aufgezeichnet und gespeichert werden können.
Es war keine einseitige Veranstaltung, nicht zuletzt dank der aktiven Teilnahme aller Anwesenden, die nicht nur stumm zuhörten sondern beispielsweise mit einer wichtigen Klärung in die Unterhaltung eingriffen: Die zwei Bedeutungen von privat, die sich in der Debatte zu vermischen drohten: Privat im Sinne von persönlicher Privatsphäre und privat im Sinne von Eigentum und Unternehmen. Die Internet-Infrastruktur unterliegt weitestgehend solchen privaten Eigentumsverhältnissen, und da sei das Problem.
Hierauf fand wiederum Till Kreutzer überzeugende Argumente. Seiner Meinung nach sollten nämlich Regierungen das Internet nicht ‚besitzen‘. Viel wichtiger sei eine effektive Regulierung, die geschaffen werden müsse. Eigentum vs. Kontrolle – Der Staat muss kein Anbieter sei, um Regeln für das Internet zu schaffen. Gäbe es erst ein Menschenrecht auf Internetzugang, so wären Staaten gezwungen, die Effektivität von Regulierungsmaßnahmen zu verbessern.
Erfrischend auch der Einwurf einer Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes, die nicht verstehen wollte, was vom Staat eigentlich erwartet wird. Aktivisten seien Individuen, die gewählten Volksvertretern gegenüber stünden. Das Parlament sei ja nicht umsonst vom Volk in diese Position gebracht worden. Wieso sollten jetzt Politiker stärker auf bestimmte Lobbyisten hören, wenn diese doch nur einen kleinen individuellen Meinungskreis darstellten?
Ja, warum? Hat jemand darauf eine Antwort, vielleicht? Warum sind wir überhaupt hier?
Minka Stoyanova übernahm es, ihr zu erklären, wieso Regierungen und Parlamente mit vielen Prioritäten auf die Stimmen der Zivilgesellschaft als Anwälte für nicht kommerzialisierbare Interessen angewiesen ist, wie sich dort das sofortige Feedback konstituiert was man sonst nur alle vier Jahre bekäme.
Die Panelisten fassten zusammen, dass Bildung und Medienkompetenz gestärkt werden müssten, um sich besser in der virtuellen public sphere zurechtzufinden (MS), der Zugang zum Internet ein Menschenrecht werden sollte (TK), Erwartungen an Firmen formuliert werden müssten, sich an Menschenrechte zu halten (RFJ), und das öffentliche Interesse definiert werden sollte, um die Übersetzung in die digitale Welt zu ermöglichen (AM).
Kaputtes Internet? Achso.
Aus diesem Workshop ging ich etwas erhellter als aus den Paneldiskussionen. Natürlich gab es kein konkretes Ergebnis, aber das war wohl auch nicht die Erwartungshaltung. Viel eher hatte ich das Gefühl, diesmal tatsächlich Leuten beim Nachdenken zugesehen zu haben und nicht nur beim Reproduzieren vorformulierter, mittlerweile bedeutungsloser Statements. Vielleicht kam dieses Gefühl auch nur, weil in einer kleineren Gruppe die Interaktivität viel höher ist, und damit auch der Anreiz, selbst mitzudenken. Die großen Panels gehören für mich eher in die Kategorie Blend- und Füllwerk. Trotzdem sah ich mir noch eines an, darüber, wie man wieder Vertrauen ins kaputte Internet bringen könne.
Die Gästeliste war bestechend (Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, Jacob Appelbaum, Cornelia Kutterer von Microsoft, Matthias Traimer vom Bundeskanzleramt Österreich und Ben Scott von der stiftung neue verantwortung). Dann allerdings: Was ist Vertrauen für Sie? Tragen Sie das doch in unser interaktives Wiki ein. Hm. Ich weiß nicht genau, worum es dann ging, alles und nichts. Das Plenum wachte erst wieder auf, als Jacob Appelbaum die Vertreterin von Microsoft, Cornelia Kutterer, öffentlich fragte, ob Caspar Bowden, Kämpfer für Privatsphäre, jetzt seinen Job als Privacy-Advisor bei Microsoft zurückhaben könne, nachdem man ja jetzt alle Sicherheitslücken schließen wolle?
.@ioerror enlivens #eurodig_pl3 by asking @ckutterer if Microsoft will give me my job back to „clean house“ (!) #eurodig
— Caspar Bowden (@CasparBowden) 12. Juni 2014
Kutterer meinte, sie wüsste auch nicht genau, was da vorgefallen sei, Bowden wäre ein guter Mitarbeiter gewesen, und hatten wir nicht ein anderes Thema.
Der erste Tag der Konferenz war lang, aber die Kaffeeversorgung war gut. Das muss man dem EuroDIG lassen. Ansonsten setzten sich eine Menge Leute in Szene, redeten viel, sagten weniger. Als das letzte Plenum vorbei war, war ich schon eigentlich ganz froh. Es gab ja noch einen zweiten Tag. Ich finde, der passt noch einmal in einen eigenen Artikel.


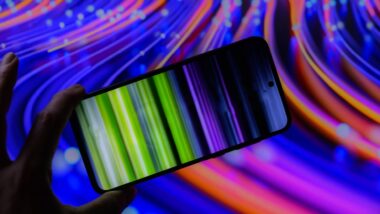

0 Ergänzungen
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr, daher sind die Ergänzungen geschlossen.