Drei deutsche Landeskriminalämter wollen Anwendungen zur polizeilichen Vorhersage von Straftaten testen: Bayern hat bereits eine Versuchsreihe zum „Predictive Policing“ gestartet. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben sich noch nicht auf eine konkrete Software festgelegt, holen aber Informationen zu Erfahrungen von Polizeibehörden in anderen Ländern ein.
Vielfach ist unklar was mit „Predictive Policing“ eigentlich gemeint ist. Auch das Bundeskriminalamt (BKA) plant deshalb laut einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums eine Auswertung entsprechender kriminologischer Ansätze und Theorien. Das hat das BKA auch bitter nötig, denn in seiner Einschätzung von „Predictive Policing“ wird mit Falschbehauptungen hantiert. So heißt es beispielsweise zur Definition von „Predictive Policing“, dessen Fokus liege auf dem Deliktsbereich „Wohnungseinbruchdiebstahl“. Das ist Quatsch, denn sogar die bayerische Landesregierung hat angekündigt, dass Tests zwar hierauf beschränkt seien, die Anwendungsgebiete im Erfolgsfalle aber erweitert würden.
Uns liegt eine Studie des Landeskriminalamtes Niedersachsen vor, die „Predictive Policing“ theoretisch betrachtet und dessen Wirkungsweise analysiert. Darin heißt es, dass nach einer aktuellen Umfrage in den USA 70 % der befragten Polizeidienststellen entsprechende Anwendungen einsetzen; insgesamt 90 % würden die Implementierung bis 2016 planen. Auch in Großbritannien, Südafrika oder Australien wird „Predictive Policing“ eingesetzt.
Verräumlichung von kriminalistischen Falldaten
Der Markt für polizeiliche Vorhersagesoftware ist mittlerweile stark gewachsen, es existieren sogar diverse Freeware-Programme. Pionier und Marktführer ist der IT-Konzern IBM mit seiner Software „Blue Crush“. Mittlerweile erhält IBM Konkurrenz vom System „PredPol“, das von einigen Universitäten mit der Polizei Los Angeles entwickelt wurde. Die meisten Anwendungen verknüpfen statistische Falldaten mit raumbezogenen Informationen, aber auch einem Veranstaltungskalender, Wetterdaten oder Zahltagen an denen viel Geld im Umlauf ist. Andere Hersteller bieten aber auch Vorhersagen auf Täterebene an oder verarbeiten Informationen zu Opfern.
Die Studie des LKA Niedersachsen unterteilt die Software in drei verschiedene Ansätze:
- Fortschreibung von Hot-Spots (räumliche Brennpunkte) und Hot-Dots (Personen, die aufgrund bestimmter Eigenschaften und Verhaltensweisen immer wieder Opfer werden) in die Zukunft. Zugrunde liegt die Annahme einer großen Konstanz dieser Gebiete und Personen.
- Nutzung univariater Methoden, bei denen auf Messungen einer Variable – in diesem Zusammenhang meist die Straftaten – in der Vergangenheit auf die Zukunft geschlossen werden soll.
- Verwendung multivariater Verfahren, wobei zunächst diejenigen unabhängigen Variablen identifiziert werden müssen, die auf die abhängige Variable „Kriminalität“ Einfluss nehmen.
Theorien aus den 1970er Jahren
In der Verbrechenssoziologie wird seit den 1970er von der „Repeat Victimisation“ gesprochen, die sich Vorhersagesoftware zunutze macht. Gemeint ist die Annahme, dass Orte oder Personen mehrfach aufgesucht („viktimisiert“) würden. „Re-Viktimisierungen“ finden demnach sehr bald (meist bis 48 Stunden danach) nach den vorherigen Ereignissen statt. Dies lässt sich leicht in einen Algorithmus umwandeln. Vielleicht erklärt dies die momentane Beschränkung der in Deutschland getesteten Software auf Wohnungseinbruch, denn dort wurde die „Repeat Victimisation“ häufig getestet. Allerdings wurde die Hypothese laut der Studie in den USA auch im Zusammenhang mit Feuergefechten, KFZ-Diebstahl oder Raub ausgeweitet und später um die „Broken Windows-Theorie“ ergänzt.
Eine weitere theoretische Grundlage ist die „Routine-Activity-Theorie“, die regelmäßige Tätigkeiten untersucht und einbezieht. Zu diesen Routineaktivitäten gehört das Ausgehen am Wochenende, der Besuch von Großveranstaltungen oder das Pendeln zur Arbeit. Auch die in Bayern eingesetzte Software macht sich dies zunutze, indem Daten von Großveranstaltungen oder Verkehrsdaten eingebunden werden. In einer ähnlichen Herangehensweise wird ein „Lifestyle Approach“ angenommen, der bestimmte Tätigkeiten nach Alter, Geschlecht, Einkommen, Familienstand oder Bildung zuschreibt. So kann etwa berücksichtigt werden, in welchen Gegenden Menschen mit hohem Einkommen oder wenig Bildung leben, was dann Rückschlüsse auf bevorstehende Straftaten erlauben soll.
Von Stecknadeln zur digitalen Glaskugel
Genau genommen ist „Predictive Policing“ eine Weiterentwicklung von Geoinformationssystemen (GIS), die seit rund 20 Jahren bei Polizeibehörden weltweit Einzug hielten und die aus Krimis bekannten Stecknadeln abgelöst haben. So heißt es in der Studie, 1997 hätten annähernd die Hälfte aller großen US-Police Departments angegeben, automatisiertes „Crime Mapping“ zu nutzen. 2001 habe dieser Wert bei rund 70 % gelegen, mittlerweile gehe man von annähernd 100 % aus.
Die niedersächsische LKA-Studie erklärt, wegen der Vielzahl einbezogener Daten und der räumlichen Darstellung von Mustern habe das „Crime Mapping“ durch Geoinformationssysteme bereits viele Eigenschaften des „Predictive Policing“ (auch hier vertritt das BKA übrigens eine andere Auffassung). Allerdings hätten die frühen Geoinformationssysteme keine Prognosen erstellen können, da die Rechnerleistung damals schlicht zu gering gewesen sei. Eine höhere Leistungsfähigkeit, ein Preisverfall der Hardware sowie die zunehmende Einführung elektronischer polizeilicher Vorgansbearbeitungssysteme Daten würden nun die Einführung von „Predictive Policing“ erlauben. Allerdings seien die Anwendungen im Gegensatz zu Geoinformationssystemen äußerst kostspielig.
Immenser Preisunterschied zwischen Geoinformationssystemen und „Predictive Policing“
Die Antwort des Bundesinnenministeriums belegt diesen Preisunterschied. Das BKA testet die IBM-Software „Content Analytics“ und gibt hierfür 515.000 Euro aus. Nach einer Einführung entstünden jährlich weitere Kosten, die sich – bei lediglich einer Anwendung – auf rund 250.000 Euro belaufen dürften. Die beim BKA eingesetzten Geoinformationssysteme sind im Vergleich dazu spottbillig. Unter anderem wird dort die Software „Regiograph Analyse“ genutzt, die einmalig 998 Euro kostete. Die Abteilung Polizeilicher Staatsschutz im BKA setzt zur Auswertung geografischer Daten „ArcGIS Desktop“ und „PAD Mobifilter“ ein. Die Lizenzkosten bewegen sich jeweils um die 3.000 Euro. Kartendaten kommen vom Bundesamt für Kartographie.
Auch Daten aus der Telekommunikationsüberwachung werden räumlich zugeordnet. Hierfür nutzt das BKA eine „TKÜ-Fachanwendungssoftware“ des Überwachungsdienstleisters Syborg, als Kartenmaterial wird OpenStreetMap eingebunden. Auch die Fallbearbeitungssoftware von rola Security Systems beim BKA und bei der Bundespolizei verfügt über Georeferenzierung. Zum Zuge kommt ein Plug In, für deren Anschaffung die hochpreisige, nun von T-Systems gekaufte Firma rola bis zu 41.850 Euro verlangt.
Prima das mit der Datensammelwut
Am Ende fragt die Studie nach der Wirksamkeit von „Predictive Policing“. Die bereits existierende Datensammelwut der Polizei wird dabei als „positiv und hilfreich“ bewertet, denn dadurch verfügten die Behörden über eine „Vielzahl von Statistiken“, die im Rahmen von „Predictive Policing“ genutzt werden können. Viele der Systeme würden auch Tat- oder Personenmerkmale erfassen. Als Beispiel wird das niedersächsische Vorgangsbearbeitungssystem NIVADIS genannt, das demnach über mehr als 750 recherchierfähige Variablen verfüge. Viele weitere Informationen lägen „frei zugänglich“ bei statistischen Landesämtern und Ämtern.
Allerdings äußert sich die Studie auch kritisch über die angeblichen Erfolge der Software. So würden mitunter Untersuchungen zu Erfolgen von „Predictive Policing“ ergeben, dass die Delikte von Jahr zu Jahr abnähmen. Würden aber andere Zeiträume verglichen, sei der Erfolg womöglich weit weniger groß. Außerdem sei das Kriminalitätsaufkommen auch in anderen Städten, die keine Vorhersagesoftware nutzen, ebenfalls gesunken. Womöglich liege der vermeintliche „Erfolg“ der Software auch in der Marketingstrategie der Hersteller begründet, die im Falle von „PredPol“ sogar als aggressiv beschrieben wird (auch darüber hatten wir berichtet).
Polizei wird ermuntert, noch mehr Daten zu sammeln
Das „Predictive Policing“ macht sich die in allen Bereichen zunehmende Digitalisierung der Polizeiarbeit mit den dadurch verbundenen Möglichkeiten zunutze. Bestände von Datenbanken können miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die wissenschaftliche Debatte benutzt hierfür der Begriff „Data Mining“. Um die Wirksamkeit solcher Verfahren zu erläutern, wird gern der Vergleich mit der Nadel im Heuhaufen bemüht: Die kann umso besser gefunden werden, je mehr Daten angehäuft und verarbeitet werden. Der Heuhaufen wird also vergrößert. So wird die Polizei ermuntert noch mehr Daten zu sammeln. Im Endeffekt könnten Innenministerien die Einführung der Software sogar als Begründung für die Einrichtung weiterer Datenbanken anführen.
Auch im IT-Bereich zeigt sich damit ein allgemeiner Trend in der Polizeiarbeit, mit immer mehr Kompetenzen zur „Gefahrenabwehr“ das Vorfeld von Straftaten zu erkunden.
Die Projekte in Niedersachsen, Bayern und NRW sind Versuchsballons, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Die Software hält dadurch Einzug in den Polizeialltag. Wird die Vorhersage von Straftaten Computern überlassen, bekommen Programmierer die Definitionshoheit über das Ranking unliebsamen Verhaltens. Wie bei Suchmaschinen wird die Reihenfolge der gefundenen Ergebnisse nicht infrage gestellt wird. Auch PolizistInnen vertrauen also der vorhersagenden Analyse, ohne zu wissen wie diese überhaupt zustande kommt. Denn der Quellcode der Software ist gewöhnlich Betriebsgeheimnis der Hersteller, mithin auch Datenschützern unbekannt.
Software fördert Stereotype bei der Polizei
Dies wiegt umso schwerer, wenn nach einigen Jahren auch Personendaten verarbeitet werden. Die britische Polizei hat hierzu kürzlich ein Pilotprojekt beendet, das die Wahrscheinlichkeit der Rückfälligkeit von Gang-Mitgliedern bestimmen soll. Verarbeitet wurden Daten von bereits straffällig gewordenen Personen, die Software griff hierzu auf Polizeidatenbanken und andere Statistiken zu.
Eine Software gegen Wohnungseinbrüche oder Fahrzeugdiebstähle wird auch die Vorurteile bei PolizistInnen verstärken. Denn ein computergestütztes Vorhersagesystem liefert keine Anhaltspunkte, wie denn vermuteten „Verbrecher“ auszusehen haben oder zu erkennen wären. Eine Reportage der ARD hat gut dokumentiert, wie dann die üblichen Stereotypen bedient werden: Kontrolliert werden Menschen mit dunkler Hautfarbe, Kapuzenpullis und andere, offensichtlich unterprivilegierte Personen.
Da klingt die Aussage eines „Erfinders“ von Vorhersagesoftware wie eine Drohung wenn er behauptet, in zehn Jahren werde „Predictive Policing“ bei Polizeibehörden Standard sein. Angeblich klopfen „Polizei-Verantwortliche aus ganz Europa“ bei dem Hersteller in Nordrhein-Westfalen an.

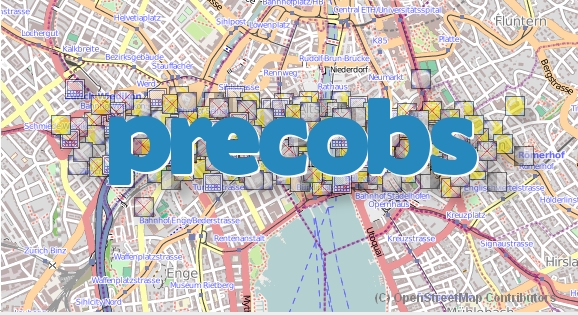
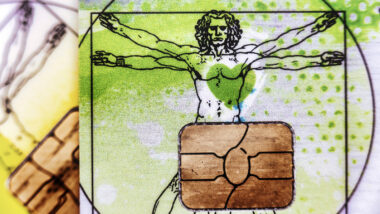


In der DDR hat sich der sogenannte Abschnittsbevollmächtigte (ABV) bei der Polizei bewährt. Der kannte die Brennpunkte in seinem Gebiet. Auch manche Pappenheimer. Und er hatte über die Jahre ein gutes Gespür für mögliche Delikte erlangt. Zusätzlich kannten ihn alle in dem Gebiet Wohnenden und konnten mit Fragen und Beobachtungen zu ihm gehen. Meist waren diese Polizisten sehr angenehm im Umgang mit der Bevölkerung. Wenn wir das politische System dahinter mal ausblenden, war es eine gute und effektive Sache, die vor allem auch ein Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung erzeugte. Man hatte in Sicherheitsfragen zumindest einen ausgewählten menschlichen Ansprechpartner.
Das wäre heute natürlich viel zu kostspielig. Billiger ist da Software, die das vermeintliche Sicherheitsgefühl herstellen soll. Zudem müssen für eine wirklich praktische Anwendung möglichst alle digitalen Daten des polizeilich zu schützenden Territoriums gesammelt werden.
Ein ABV ohne digitale Sammelwut wäre mir deutlich lieber!
Die ArcGIS Lizenz mit 3000 € im Jahr kann aber fast nur eine Einzelplatz Lizenz seien. Und der unterschied zwischen einem richtigem GIS system und einem pre crime dingens ist wohl eher dass in den Systemen für crime analysis standard verfahren auf Knopfdruck ausgefuhrt werden können.
Datengestützte Einsatzplanung gab es schon vor über 40 Jahren bei Horst Herold!
Es macht die Arbeit der Polizei einfacher wenn Alltagsrassismus in Software implementiert wird, das ist dann ja „Objektiv“ und nix persönliches mehr.
Und wenn die Software funktioniert brauchen wir auch weniger Polizisten, daher darf das auch ein wenig teurer sein – günstiger als Personalkosten ist das allemal.
Un d richtig spannend wird es erst wenn die API für die VDS kommt, dann wird Predicitve Policing zu Realtime Good Governance, denn dann sieht die Überwachungszelle sofort anhand von Bewegungsprofil und Zielgruppe und wenn eine verdächtige elektronische Fußfessel im Quartier auftaucht (oder halt ein iphone)
Und der DDR Abschnittsbevollmächtigter hieß bei den Nazis noch Blockwart – falls einem hier die feine Ironie verborgen blieb.
Es ist schon ekelhaft, wie Nelli hier gleich mit dem Begriff „Alltagsrassismus“ um sich wirft.. Ich glaube echt mittlerweile drehen in Deutschland alle durch!
Die „German Angst“ treibt die Leute zur totalen Selbstaufgabe und zum totalen Selbstverrat…