Morgen erscheint bei Random House ein Interviewbuch mit unserem Verteidigungsminister Thomas de Maiziere, das auf Gesprächen mit dem Journalisten Stefan Braun basiert: „Damit der Staat den Menschen dient. Über Macht und Regieren.“ Aus netzpolitischer Sicht sind nur rund zehn der 384 Seiten interessant (321ff). Die zeigen dann auch den thematischen Abstand zu unserem jetzigen Innenminister, ich möchte gar nicht wissen, was dieser auf zehn Seiten auf die Fragen antworten würde. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was de Maiziere zu sagen hat, ganz im Gegenteil, aber er kann zumindest argumentieren und hat Punkte.
Es fängt an mit der Vorratsdatenspeicherung, die ein „Riesenthema“ zu seiner Innenminister-Zeit war. Er ist etwas traurig darüber, dass es ihm und anderen nicht gelungen ist, den Begriff zu ändern:
Dabei freilich kann man mal wieder lernen, welche Wirkung Begrifflichkeiten haben können. Beim Wort »Vorratsdatenspeicherung« wird bei vielen der Eindruck erweckt, der Staat wolle auf Vorrat alles speichern. Und weil es um Daten gehe, meinen alle, es gehe auch darum, Inhalte zu speichern. Wir haben deswegen versucht, andere Begriffe zu finden, das war aber alles vergeblich. Der Begriff war eingeschliffen, den kann man nicht mehr ändern. So ist das halt. Dabei geht es eigentlich nur darum, dass wir die Rückverfolgungsmöglichkeiten von Verbindungen bei anderen, nämlich bei privaten Anbietern, sicherstellen wollen.
Achso, ich dachte immer, die Speicherung wäre früher notwendig gewesen, falls die Rechnung angezweifelt wird.
Etwas also, was viele Jahre lang ganz normal war. Denn lange Zeit bekam jeder bei seiner Telefon- oder Handyrechnung einen Einzelverbindungsnachweis, wenn er es wollte, zum Beispiel, wenn er die Höhe der Rechnung anzweifelte. Noch Monate, vielleicht Jahre später konnte man diese Verbindungsdaten haben. Und das war unter bestimmten Voraussetzungen für die Polizei zugänglich, gegebenenfalls mit richterlicher Genehmigung.
Vielleicht Jahre später? Das ist mir jetzt neu. Was auch neu ist, sind die Funkzellendaten, die Bewegungsprofile ermöglichen, wo jemand die letzten Monate mit seinem mobilen Device war. Und die automatisierten Auswertungsmöglichkeiten, …
Auf die Zwischenbemerkung des Interviewers „Die Gesellschaft will es einfach nicht“ beschreibt de Maiziere seine Verwunderung, warum das Thema Sicherheit plötzlich bei der Vorratsdatenspeicherung nicht mehr zog:
Die Zustimmung zur Vorratsdatenspeicherung ist nicht groß. Das stimmt. Es war Jahre, vielleicht Jahrzehnte eigentlich so, dass die Union immer dann, wenn sie erklärte, man müsste dies oder jenes bei der Sicherheit tun, eine breite Zustimmung erhielt. Bei der Vorratsdatenspeicherung war das zum ersten Mal anders. Auch durch den Begriff. Vielleicht auch durch das Grundgefühl, dass der Staat sich beim Internet plötzlich irgendwelche Rechte nimmt, die man ihm nicht geben will. Also ist die Zustimmung zum ersten
Mal bei diesem Thema nicht mehr wirklich da. Ich habe aus meiner Sicht der Justizministerin viele Angebote gemacht, aber mir ist letztlich kein Kompromiss eingefallen zwischen anlassloser und anlassbezogener Datenspeicherung. Irgendetwas dazwischen gibt es halt nicht. Im Interesse der Sicherheit bedaure ich sehr, dass mir das nicht gelungen ist.
Das mit dem Grundgefühl, dass der Staat „sich beim Internet plötzlich irgendwelche Rechte nimmt“ hat er ganz gut verstanden. Da kann man die Onlinedurchsucherung noch direkt dazu packen. Und zahlreiche andere Überwachungsmaßnahmen der letzten Jahre.
Dann geht es zu auch zum Thema Netzneutralität, wo de Maiziere zumindest rhetorisch eine andere Meinung zu haben scheint, als die Linie der Bundesregierung ist, die hier auf den Markt vertraut.
Bisher haben wir uns darauf verlassen, dass jede Information transportiert wird. Was aber, wenn das nicht mehr der Fall ist? Was, wenn das Netz gewissermaßen voll ist? Ja, bislang haben wir noch genügend Kapazitäten. Das Ganze nennt man Netzneutralität. Wir haben noch genügend Kapazitäten, damit alle Inhalte im Netz von A nach B transportiert werden. Was aber, wenn sich das ändert? Oder was, wenn die Firma Google oder Facebook oder einer der anderen Großen sagt: »Ich werde den Inhalt der Firma A nicht mehr transportieren, zum Beispiel aufgrund eines privaten Vertrags mit einem Konkurrenten von A.« Oder sagt: »Ich transportiere Inhalte der Firma B vorrangig.«
Das ändert sich ja gerade, z.B. mit dem Spotify/Deutsche Telekom – Deal. Macht die Bundesregierung jetzt was?
Dann kommt plötzlich der Zugang zu Informationen durch Transporteure, Provider einer inhaltlichen Informationszuteilung
gleich. Das ist eine Ungleichbehandlung, die wir bei anderen Infrastrukturen nicht zulassen. Beim Strom haben wir das längst gelöst. Wir haben Regeln, wer welchen Strom transportieren muss. Muss! Bei den Informationsinhalten im
Netz haben wir das nicht. Ich bin der festen Überzeugung: die Aufrechterhaltung der Netzneutralität, also Netzsicherheit und Gleichbehandlung, ist auch eine öffentliche Aufgabe. Ich weiß, dass das national gar nicht mehr geht. Das muss international
geregelt werden. Aber es muss eigentlich dringend geregelt werden.
National kann man anfangen, wie z.B. die Niederlande zeigen. Und dann kann man sich auf EU-Ebene für bessere Regeln einsetzen. Müsste man mal.
Dann geht es in die Richtung einer staatlichen Pflicht, vor Software zu warnen oder zu verbieten. Er sieht aber ein, dass es „ganz schwierig“ ist, „Softwarezulassungsvoraussetzungen zu formulieren“. Aber solche Fragen kann man nicht stellen weil:
Für Autos gibt es eine TÜV-Pflicht. Was wir natürlich anderswo laufend machen. Kein Auto darf fahren, ohne dass es zugelassen ist. Kein Flugzeug fliegen. Und so weiter und so weiter. Doch schon das Stellen dieser Fragen wird von der Internetcommunity oft als Zumutung empfunden. Trotzdem glaube ich, dass es auf lange Sicht eine Schutzpflicht des Staates beziehungsweise der Staaten gibt, damit wir nicht abhängig werden von einigen großen Unternehmen, die im Internet übermächtig werden.
Man stelle sich tatsächlich mal vor, jede Software müsste bei einem Update erstmal zum TÜV. Wünscht sich sicher die TÜV-Lobby, damit kann man Millionen Arbeitsplätze schaffen und wer soll das denn sonst machen? Das BSI?
Es geht weiter mit der Klarnamenspflicht. Die verkauft de Maiziere tatsächlich als „zivilisatorischen Fortschritt“:
Wir haben damals gesagt, dass es an sich doch ein großer zivilisatorischer Fortschritt gewesen ist, dass wir den Menschen personalisieren. Dass wir Namen haben, mit Namen auftreten, uns kenntlich machen und unterscheiden können, Gesicht zeigen. Banales Beispiel: Bei einer Diskussionsveranstaltung sagt der Veranstaltungsleiter: »Bitte sagen Sie doch Ihren Namen und wo Sie herkommen, und dann stellen Sie Ihre Frage.« Und dann macht man das. Das gehört zur Zivilisation dazu.
Das ist Höflichkeit, aber keine Verpflichtung, überall mit seinem Klarnamen rumzulaufen und identifiziert zu werden.
Dann erklärt de Maiziere die DE-Mail und man hat beim Lesen das Gefühl, dass dafür doch dann PGP ausreichen sollte:
Wenn wir also im Internet im Postkartenbereich sind, dann ist es eben nicht geschützt. Jeder muss wissen, der eine Mail verschickt, dass da jeder, der es will und clever ist, reingucken kann. Wie bei einer Postkarte. Wenn man aber einen Briefumschlag zuklebt, dann muss man analog auch die E -Mail schützen. Wenn man die schützt, gibt es auch erhöhte Zugangsschranken.[…] Aber dass wir gleichzeitig sagen: Wenn die öffentliche Infrastruktur, wenn die öffentliche Sicherheit davon abhängig ist, wenn gewissermaßen der Briefumschlag zugemacht wird, wenn Ihr wollt, dass es ein Brief ist und keine Postkarte, dann müsst ihr Euch einem bestimmten Regulatorium unterwerfen. Das und nur das schützen wir.
Lustig fand ich folgende Stelle:
Ich wage mal eine Vorhersage: Ein wesentlicher Teil der Datenschützer wird noch auf den Staat zukommen und sagen: »Schützt unsere Daten vor den großen Unternehmen.« Oder sie sagen sogar: »Ihr habt eine Fürsorgepflicht, dass Private unsere Daten nicht missbrauchen.« Wie das dann gehen soll, weiß ich nicht. Das ist sehr schwer und eine hochspannende Fragen.
Das klingt jetzt so, als ob de Maiziere zu seiner Bundesinnenminister-Zeit gar nicht mitbekommen hat, dass er auch Datenschutzminister war und nicht nur der wesentliche Teil der Datenschützer dies schon ewig vom Staat fordert, nämlich bessere Datenschutzregeln zu schaffen und durchzusetzen, z.B. momentan im Rahmen der EU-Datenschutzreform.
Dann geht es noch weiter zu Google Streetview, wo er die Empörung übertrieben fand und lustigerweise findet er Google Earthview krasser, weil der „Eingriff in das private Leben viel gravierender“ sei, wenn man „von oben“ „in jeden Garten gucken“ kann! Wie war das mit der Drohnenpolitik der Bundesregierung? Wird de Maiziere dagegen nach Karlsruhe ziehen, um seinen Garten zu schützen?
Den Rest des Buches hab ich noch nicht gelesen, ich kann also nichts dazu sagen, ob man dafür 22,99 Euro ausgeben sollte.


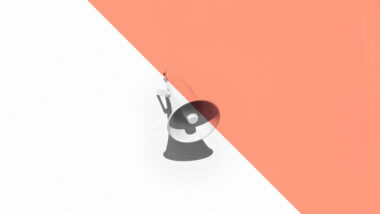

Also ich wusste nur, dass VDS ein der Öffentlichkeit unverkäuflicher Begriff war, keiner hat es während der parlamentarischen Phase richtig verstanden, und dann kam der Heise-Bericht, wo jemand die Formel der „verdachtsunabhängigen Speicherung von Verbindungsdaten“ erwähnte. Und plötzlich machte es klick.
Der absolute Phrasenreinfall des BMI ist aber der „Bundestrojaner“, wo es dem CCC gelang, dass diese Spottphrase von allen Seiten aufgegriffen wurde.
DE-Mail, ich erinnere mich nur, dass ich vor mehreren Jahren auf der Cebit einen Vortrag gehört habe und mich wunderte, was daran so viel Geld kosten soll.
Es wäre einfach mal gut, wenn der Staat mal wirklich eingreifen würde, damit die IT-Sicherheit steigt. Die Bundesrepublik hat die ganzen Empfehlungen aus dem Echolon-Bericht verschlafen, insbesondere zur Abwehr von Wirtschaftsspionage, aber auch ganz praktische funktionierende Ideen:
Unglaublich – da kann man im besten Falle nur sagen, welch eindimensionale Betrachtungsweise ein Minister heute doch haben muss. Der sabbelt sich irgendetwas mit gefährlichem Halbwissen zusammen, jongliert mit irgendwelchen Schlagworten und versucht sie mit seiner begrenzt vorhandenen Vorstellungskraft logisch zu argumentieren. Aber immer so, dass der Eindruck entsteht, der Staat muss es letztendlich regeln.
Wer ist der Staat, Herr Maiziere? Glauben Sie etwa die Regierung? Sie sind nur Angestellter des Volkes und sind durch den Souverän in diese Position gekommen. Sie sollten sich entsprechend verpflichtet fühlen. Scheinbar reichen aber seine Ausführungen für seine Klientel, weil die selber auch nicht mehr wissen.
Mit reicht jedenfalls der Auszug um zu wissen, dass er über andere Themen in dem Interview mit Sicherheit auch keine interessanten Dinge beizutragen hat. Es besteht eher die Befürchtung, dass er auch in den anderen Themenfeldern nur verquere Selbstideologien vertritt.
Was hat es denn mit dieser kurz erwähnten Spotify/Telekom Geschichte auf sich?
http://netzwertig.com/2012/12/14/spotify-flatrate-der-telekom-die-neue-macht-der-mobilfunk-provider-ist-fluch-und-segen-zugleich/
Ehrlich gesagt war de Maiziere der einzige Innenminister der letzten zehn Jahre, der den Eindruck macht als habe er das Grundgesetz zumindest mal gelesen. Sicherlich ist er nicht immer der gleichen Meinung wie „die Netzgemeinde“, aber soweit ich das mitbekommen habe war er wenigstens zugänglich für Argumente und hat Andersdenkende nicht gleich als Kriminelle hingestellt. Bis auf de Maiziere wurden unsere Innenminister ja immer schlimmer: Erst Schily, dann Schäuble, und jetzt Friedrich, der dem ganzen, zumindest rhetorisch, die Krone aufsetzt.
Aber ein kompetenter Innenminister darf in Deutschland ja nicht sein, der könnte sich ja von der Sinnlosigkeit und der Gefahr neuer Überwachungsgesetze überzeugen lassen. Deswegen hat man de Maiziere bei der nächsten sich bietenden Gelegnheit wieder wegbefördert und mit der schlechtestmöglichen Person ersetzt, die auf die Schnelle zu finden war.
Sorry, aber das musste mal raus.^^
Genau das machte de Maizière so gefährlich. Deswegen war ich heilfroh, als der wieder durch einen Holzschnittinnenminister ersetzt wurde. Denn einer, der auf die Argumente eingeht, sachlich und kompetent dazu, aber grundsätzlich ein Sicherheitsminister, also ein Freiheitseinschränkungsminister sein will, der kann der Freiheit richtig ernsthaft Schaden zufügen.
So einer wie Schily also, hm? Jetz‘ nich‘ im Ernst, oder?
Lieber ein Minister, bei dem man sich dann mit dem Wesentlichen und mit Fakten auseinander setzen kann, als einen, der einen ständig mit Nebelkerzen („Organisierte Kriminalität“ (Schäuble, vor dem 9.11.2001 wohlgemerkt), „Islam, Islam, Islam!“ (pick any one, particularly Friedrich zum Einstand, …) auf Trab und damit vom Wesentlichen ab-hält.
OFFTOPIC:
Eine neue Petition an den Bundestag
„Der Deutsche Bundestag möge beschließen, die bisherigen Regelungen zum Arbeitslosengeld II, insbesondere §§ 2, 10, 15 und 31 SGB II, mit sofortiger Wirkung aufzuheben und eine in finanzieller oder materieller Höhe bedingungslose Grundbedürfnissicherung für alle erwerbstätigen und erwerbslosen Bundesbürger gleichermaßen einzuführen.“
https://www.grundeinkommen.de/09/03/2013/petition-an-den-bundestag.html
Würde mich freuen, wenn die Geschichte in der Bloggosphäre noch ein bischen gepitched wird!
Vorschlag an die Halbwissen Politiker(diverse)Unternehmer-Lobbyisten Kaste:Geht mal einige Monate in die Kriegsgebiete,lebt dann noch von Hartz 4,mindestens 2 Jahre.-Schon vergessen Hartz 1 bis 3 war der Anfang vom Ende… Vorsicht Wahlk(r)kampf Versprechungen kommen auch noch.
Hmm,
natürlich kann ich persönlich auch sehr gut verstehen, dass einem solche Datenspeicherung unheimlich ist. Aber als Unternehmer bin ich auch offline verpflichtet Buchhaltungsunterlagen und Kundenkommunikation (Briefe, Bestellscheine, Anfragen) über lange Jahre aufzubewahren. Bestelldaten würde ich alleine schon aus Eigeninteresse bis nach Ablauf der entsprechenden Rechnungs-Verjährungsfristen (also 3 Kalenderahre) aufbewahren.
Insofern ist mir die Ablehnung der Speicherung von konkreten Verbindungsdaten in der Tat rational nicht ganz verständlich.
Bzgl Klarnamenpflicht – witzigerweise kriegt Facebook von den einschlägig bekannten Datenschützern ja ständig eins auf den Deckel, weil Facebook zumindest offiziell auf einer solchen besteht. Und was würde wohl passieren wenn auf ner Partnerbörse, Diskussionsforum der anonymen Alkoholiker oder nem S/M-Blog eine solche eingefordert würde?
„Insofern ist mir die Ablehnung der Speicherung von konkreten Verbindungsdaten in der Tat rational nicht ganz verständlich.“
Die Speicherung per se ist nicht das Problem. Wichtige Unterlagen sollte man privat bis zu 10 Jahren aufheben und bei jedem Unternehmen, bei dem man einkauft, werden die Bestelldaten gespeichert. Das Problem bei der Speicherung von Verbindungsdaten ist, es sind Daten, die so nicht gespeichert werden müssten und es werden immer mehr. Dabei sind auch Daten, die man selbst nicht produziert, es wird ja immer mehr verknüpft. Zusätzlich sind die Daten, da der Anteil der digitalen Daten immer größer wird, einfach durchsuchbar. Es ist einfach die Befürchtung, dass durch unsere Daten andere einmal mehr wissen, als wird selbst. Privatsphäre verringert sich damit.
Aber direkt bei der Vorratsspeicherung ist glaube ich das größte Problem, dass da eine Tür geöffnet wird, die nicht mehr von uns geschlossen werden kann.
Es gibt den simplen Grundsatz der Datensparsamkeit: Personenbezogene Daten werden nur in einem Umfang erhoben wie unbedingt nötig für die Verarbeitung, und auch nur für eine unbedingt nötige Zeitspanne. Verbindungsdaten sind nur solange relevant für ein TK-Unternehmen, bis die monatliche Rechnung bezahlt ist, bei Flatrates fällt sogar das weg.
Wenn du das mit deinen Pflichten als Unternehmer/in dem Finanzamt gegenüber vergleichst, vergleichst du Äpfel mit Birnen.
Ich wünschte wirklich, dieser Grundsatz würde mehr ins Bewusstsein aller Beteiligten rücken. Stattdessen scheint allzu häufig ein „Macht doch nix, kost‘ doch nix, tut doch keinem weh“ sich auszubreiten – man speichert einfach, weil man kann. Und verliert dabei den Menschen aus dem Blick.
„Verbindungsdaten sind nur solange relevant für ein TK-Unternehmen, bis die monatliche Rechnung bezahlt ist, bei Flatrates fällt sogar das weg.“
Naja, und was macht das TK-Unternehmen wenn jemand nach Monaten reklamiert dass er die Mehrwertnummer niemals angerufen hätte oder seine Frei-SMS doch garnicht verbraucht sein können, da diese doch hätten übertragen werden müssen? Würde es diese Daten jeweils mit dem Lastschrifteneinzug wegwerfen, gäbs vermutlich schnell ein Problem im Kundenservice.
Wie gesagt- das Unbehagen kann ich emotional verstehn, rational aber nicht ganz nachvollziehen.
Das Problem ist der _zentrale_ (staatliche) Zugang.
Die Inhalte sind bei der VDS unerheblich, interessant sind die Kontaktdaten (wer mit wem) und die Ortsdaten (wer wann wo … mit wem), das weiß man, seit es den Feldfunk gibt, mit den Inhalten kann man kaum was anfangen. Traurig, dass das ein Verteidigungsminister nicht weiß.
„Dabei geht es eigentlich nur darum, dass wir die Rückverfolgungsmöglichkeiten von Verbindungen bei anderen, nämlich bei privaten Anbietern, sicherstellen wollen.“ Und wie passt das mit unserer Verfassung zusammen?
„Vielleicht auch durch das Grundgefühl, dass der Staat sich beim Internet plötzlich irgendwelche Rechte nimmt, die man ihm nicht geben will.“ Vielleicht liegts auch daran, dass der Staat beim Internet (und Mobiltelefonen und Festnetztelefonen) Sachen will, die er sich in anderen Bereichen nicht mal zu denken trauen würde?
Bewegungsprofile nicht zu vergessen, die bestehen grundsätzlich aus mehreren Ortsdaten über einer Zeitachse, also genau das, was die VDS will.
>> der Staat wolle auf Vorrat alles speichern <<
der staat SPEICHERT auf vorrat alles 1! :)
Wenn Herr de Maziere nicht abhängig von einigen wenigen großen Unternehmen werden will, könnte er ja verstärkt Open-Source-Programme in seinem Ministerium einsetzen. Mir ist aber nicht bekannt, dass es da große Fortschritte gibt.
Erst mal vor der eigenen Haustür kehren, gell?