 Schon einige Zeit bevor Open Data und Open Government auch hierzulande breiter diskutiert wurden, standen sie in den USA auf der politischen Agenda. Wenn dann jemand wie Gavin Newsom, Vizegouvernor von Kalifornien und davor langjähriger Bürgermeister von San Francisco, ein Buch über seine Erfahrungen mit Open Government schreibt, klingt das deshalb auf den ersten Blick vielversprechend. Warum Fehler hierzulande wiederholen und nicht von den Erfahrungen der US-Vorreiter lernen?
Schon einige Zeit bevor Open Data und Open Government auch hierzulande breiter diskutiert wurden, standen sie in den USA auf der politischen Agenda. Wenn dann jemand wie Gavin Newsom, Vizegouvernor von Kalifornien und davor langjähriger Bürgermeister von San Francisco, ein Buch über seine Erfahrungen mit Open Government schreibt, klingt das deshalb auf den ersten Blick vielversprechend. Warum Fehler hierzulande wiederholen und nicht von den Erfahrungen der US-Vorreiter lernen?
Leider erfüllt „Citizenville“, das Newsom gemeinsam mit der Autorin Lisa Dickey verfasst hat, diese Hoffnungen nicht. Anstatt ein realistisches Bild der Chancen und Schwierigkeiten digitaler Technologien zu zeichnen, liest sich das Werk über weite Strecken wie eine Steilvorlage für Evgeny Morozovs Kritik an „Solutionism“. So heißt es gleich im ersten Kapitel:
„Technology has rendered our current system of government irrelevant, so now government must turn to technology to fix itself.“ (p. 10)
Kein Problem weit und breit, für das Internet und digitale Technologien nicht die Lösung wären. Oder wie es Carlos Lozada in einer Rezension für die Washington Post formuliert hat:
„Newsom even has a chapter titled ’There’s an App for That’ – the first unironic use of the phrase since 2009.“
Alles in allem ist „Citizenville“ ein wenig geordnetes, post-ideologisches Sammelsurium von Beispielen, wie mit Hilfe neuer Medien und Technologien staatliches Handeln besser gestaltet werden kann. „Besser“ ist für Newsom vor allem effizienter und, wo das Hand-in-Hand geht, gerne auch partizipativer. Newsom erweckt den Eindruck, als ob sich die meisten politischen Probleme lösen wie sich Schlaglöcher stopfen lassen. Politik als das Austragen von Interessenskonflikten ist im ganzen Buch kein Thema. Sinnbildlich dafür ist das letzte Kapitel mit dem Titel „The Postpartisan Age“, wo Newsom erklärt: „It’s the ideology of efficiency.“ (p. 235)
Dieses technokratische Effizienzprimat wird dann noch verbrämt mit einer kommunitaristischen Ethik, die den Wert von Privatsphäre für (städtische) Freiheit völlig unterschätzt, was deutlich wird an Sätzen wie diesem:
„But the notion of Citizenville, at its heart, is really just an updated version of the township – a place where residents gather to take care of their societal needs.“ (p. 213)
Newsom romantisiert von einem digitalen Zurück zur sich kümmernden und partizipativen Kleinstadt, die es so nie gegeben hat. Mehr noch, er definiert die Dystopie der gläsernen Stadt, wie sie Samjatin in „Wir“ entwickelt hat, zu einer naiven Post-Privacy-Utopie um (Kaptitel 3: „Living in a Glass House“). Diese gipfelt im zustimmenden Zitieren von ‚Weisheiten’ wie „My privacy policy is ‚Don’t do bad things.'“ (p. 63) oder „In a world of infinite transparency and zero privacy, it’s a lot safer“ (p. 64). Dass Newsom deshalb auch mehrfach die Vorzüge von Klarnamenspflicht betont, ist da nur folgerichtig.
Dabei ist es gerade die mit Anonymität verbundene Privatsphäre größerer Städte, die Subkulturen ermöglicht und für die sprichwörtlich freie Stadtluft sorgt. Das zu verkennen ist vor allem für einen ehemaligen Bürgermeister von San Francisco und Helden der Schwulen- und Lesbenbewegung – er hatte eigenmächtig die Ehe für homosexuelle Paare geöffnet – verwunderlich.
Hinzu kommen apodiktische Aussagen wie „We have to accept the fact that top-down hierarchy is no longer working and it won’t ever work again“ (p. xxii). Selbst jenen, die zustimmen, dass die Crowd viele Aufgaben besser zu erledigen vermag als bürokratische Apparate, dürfte diese fundamentale Ablehnung von Hierarchien wohl zu weit gehen. Ganz zu schweigen von neuen Top-Down-Hierarchien im Netz, die von Google, Facebook und anderen Plattformbetreibern erfolgreich etabliert wurden.
Ähnlich auch das durchaus interessante Plädoyer im öffentlichen Bereich stärker auf Gamification – also spielerische Formen der Bürgerbeteiligung – und mit Preisgeldern ausgestattete Ideenwettbewerbe zu setzen (vgl. beispielsweise die Plattform für staatliche Ideenwettbewerbe challenge.gov, p. 147). Denn die Euphorie für Ideenwettbewerbe geht dann wieder zu weit, wenn nur noch das Ergebnis und nicht auch der Prozess zählt. So meint Newsom, dass zuviel Geld für die Entwicklung von AIDS-Medikamenten verschwendet wurde und einfach stattdessen einen Preis auszuloben effizienter gewesen wäre (p. 155) – von gruseligen Biologismen ganz zu schweigen, wie zum Beispiel wenn Peter Diamandis zustimmend zitiert wird mit „‚We are genetically bred to compete.'“ (p. 156)
Der spannendste Gedanke in Citizenville ist der Vorschlag, die öffentliche Hand sollte ein Selbstverständnis als offener Plattformprovider entwickeln. Newsom hat dabei vor allem die kommunale Ebene im Blick und fordert die Etablierung standardisierter und offener Schnittstellen:
„That ’s the beauty of an open API – any city can adopt it and then use apps and technology there as well. The more we can share, the better off we are.“ (p. 93)
Gerade auch angesichts aktueller Diskussionen um die staatliche Pflicht zur Gewährleistung von Netzneutralität ist diese These von großer Brisanz (vgl. auch Michael Seemanns These, die zentrale Forderung der Piratenpartei sei jene nach Plattformneutralität). Welche Implikationen aber aus diesem Selbstverständnis für die öffentliche Hand folgen und wo die Grenzen dieses Ansatzes liegen, dazu findet sich leider kaum etwas in dem Buch.

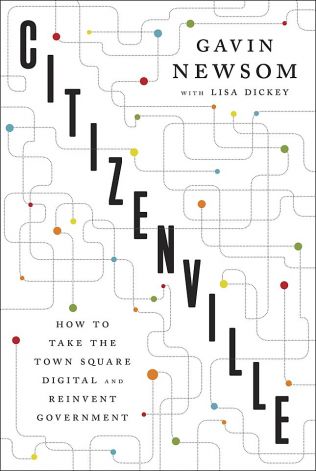



Danke fuer die gute Rezension die mich ganz gut vor einem Fehlkauf gewappnet hat. Aber mal ehrlich: Wenn ein junger, gelackter Karriere-Politiker (ich hab‘ nur kurz ins Wikipedia-Profil geschaut) mir in Buchlaenge erklaeren will, warum es ja eigentlich keine jungen, gelackten Karriere-Politiker in der Zukunft braucht dann ist die Stossrichtung doch klar: Gavin wird schoen der Chef von Kalifornien und in den Kleinstaedten koennen sie dann ‚Postdemokratie‘ spielen-am besten ohne Machtumverteilung oder Budget-Einfluss…