
In der Frage, ob ein Kunde gezwungen ist, den von seinem Provider vorgegeben Router zu nutzen, hat es in der Vergangenheit ausführliche Diskussionen gegeben. Nach einem Workshop im letzten Juni hatte die Bundesnetzagentur (BNetzA) im September öffentlich um Stellungnahmen gebeten. Bis zum Auslauf der Frist im November haben viele Organisationen, darunter FSFE, CCC und der Konsumentenbund ihre Meinungen veröffentlicht und für eine Abschaffung des Routerzwangs geworben.
Mitte Februar wurde nun als Ergebnis der Konsultationen ein Verordnungsentwurf von der BNetzA präsentiert. Dieser enthielt erfreulicherweise eine Abschaffung des Routerzwangs sowie Regelungen, die Telekommunikationsanbieter zu mehr Transparenz gegenüber ihren Kunden anhalten. Die Free Software Foundation Europe (FSFE), der Chaos Computer Club (CCC), die Projektleitung von IPFire und OpenWrt und andere haben den Verordnungsentwurf dennoch einmal näher unter die Lupe genommen.
Zwar wird der Routerzwang prinzipiell abgeschafft, jedoch liegt die Hürde immer noch recht hoch. Denn auch wenn der Kunde die Zugangsdaten für seinen Internetanschluss einsehen und damit auch einen anderen Router nutzen und konfigurieren kann, muss er dazu zunächst eine Anfrage an seinen Provider stellen. Dabei wäre es verbraucherfreundlicher, den Kunden direkt auf einem „Produktinformationsblatt“ zu informieren. Diesen soll ohnehin dem Entwurf nach obligatorisch sein, aber sieht bisher nur den verpflichtenden Hinweis vor, dass ein Austausch des Routers prinzipiell möglich ist.
Eine standardmäßige Angabe der dazu benötigten Zugangsdaten entspräche auch dem Koalitionsvertrag, der in diesem Fall fortschrittlicher ausfällt als der Verordnungsentwurf der BNetzA:
Die zur Anmeldung der Router (TK-Endeinrichtungen) am Netz erforderlichen Zugangsdaten sind den Kundinnen und Kunden unaufgefordert mitzuteilen.
Ein freier Wettbewerb ist so also weiterhin nicht gegeben, da ein Wechsel immer mit organisatorischem Aufwand für den Kunden verbunden ist und der Kunde gegenüber dem Provider in einer nachteiligen Stellung ist. Matthias Kirschner, Vizepräsident der FSFE, sieht das folgendermaßen:
Wenn die Last weiterhin beim Verbraucher liegt, die Daten zu erfragen, hat die Bundesnetzagentur kaum die Möglichkeit, die Zuverlässigkeit der Provider bei der Herausgabe der Daten zu überprüfen. So könnten Verzögerungen weiterhin mit unglücklichen Einzelfällen begründet werden. Die Verbraucher hätten am Ende mehr Komplikationen als zuvor.
Der FSFE mahnt darüber hinaus an, dass immer noch nicht geklärt ist, was genau den Netzabschlusspunkt darstellt. Eine verbraucherfreundliche und die naheliegendste Interpretation wäre es, die TAE-Dose als Ende des „Hoheitsbereiches“ eines Providers zu sehen. Eine Betrachtung des Routers als Abschluss würde bedeuten, dass der Kunde zwar eigene Geräte verwenden kann, aber erst hinter dem Router, den ihm sein Provider bereitstellt.
Ein weiterer Kritikpunkt am derzeitigen Entwurf liegt bei den Messverfahren, zu denen Provider fortan verpflichtet wären. Diese verliefen dem Entwurf nach weiterhin intransparent und die Verordnung würde weiterhin Lücken lassen, die Providern die Benachteiligung ihrer Kunden ermöglicht. Aber hoffentlich helfen Stellungnahmen wie diese, solche Lücken auszubessern und einen wirklich wirksamen Schutz vor der Übermacht der Provider zu bieten.

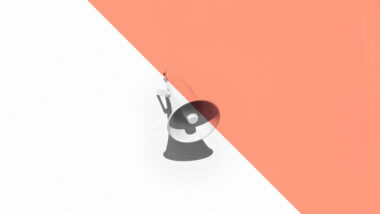


Ich wäre dankbar, wenn man endlich zur Kenntnis nehmen würde, dass ein nicht unerheblicher Teil der privaten Internetanschlüsse mittlerweile über Kabel-TV-Netze geht. Auch FTTH ist im Kommen. Daher bitte nicht die TAE-Dose als Netzabschluss definieren. Die macht nur bei DSL Sinn: Internet ist nicht gleich DSL!