Ende Januar 2020 wird langsam klar, dass etwas nicht stimmt. Bei Women on Web gehen Nachrichten ein: Ihre Website ist von Spanien aus nicht mehr zu erreichen. Wer die Adresse im Browser aufrufen will, bekommt etwa eine Fehlermeldung: „Fehler 404 – Seite nicht gefunden“. Die Ursache dafür erfährt die Organisation erst Wochen später: Die spanische Arzneimittelbehörde hatte eine Netzsperre angeordnet. Die größten Internetanbieter der Landes mussten dafür sorgen, dass ihre Nutzer:innen nicht mehr auf die Website von Women on Web gelangen.
Heute, mehr als drei Jahre später, haben sich drei verschiedene Gerichte mit der Sache beschäftigt, bis hinauf zu Spaniens Oberstem Gerichtshof. Dieser hatte im Oktober geurteilt, dass die Sperre von womenonweb.org nicht rechtens war. Und trotzdem ist die Seite bis heute von Spanien aus ohne Tricks nicht zu erreichen. Wie kann das sein?
„Illegaler Verkauf von Arzneimitteln“
Seit 18 Jahren informiert die internationale Organisation mit Sitz in Kanada kostenlos zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und sie verschickt auf Anfrage die beiden Mittel Mifepristone und Misoprostol für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, meist in Länder, wo restriktive Gesetze den Abbruch schwer machen. Mit einigen Tagen Abstand genommen, sorgen diese Medikamente mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Schwangerschaft endet, die WHO empfiehlt die Methode bis zur 12. Woche und stuft sie als sicher ein.
In Spanien waren die Behörden anderer Ansicht. Bereits im Mai 2019 schickte die Arzneimittelbehörde Women on Web eine E-Mail: Die telematische Vermarktung dieser Medikamente in Spanien sei illegal. Die Organisation dürfe keine Pillen anbieten. Denn Mifepristone und Misoprostol dürfen in Spanien nur von Ärzt:innen verschrieben werden. Aus Sicht der Behörde war es deswegen so: Weil Women on Web die Mittel an Hilfesuchende abgibt, ist damit der Straftatbestand des „illegalen Verkaufs von Arzneimitteln“ erfüllt. Dass die Organisation die Mittel gar nicht verkauft, sondern kostenlos anbietet und lediglich um Spenden bittet, machte da offenbar keinen Unterschied.
Das spanische Gesetz erlaubt seit 2019 bei Gefahren für die „öffentliche Sicherheit“ und „nationale Sicherheit“ das Sperren von Websites – auch ohne eine richterliche Anordnung. Genau das hat die Behörde getan. Nur sperrte sie eben nicht nur den Teil der Seite, wo die Medikamente angeboten wurden, sondern die gesamte Website. Das betraf auch alle Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, die Women on Web bietet. Damit ist eingetreten, wovor Organisationen wie Amnesty International schon bei der Einführung des Gesetzes gewarnt hatten: Eine Behörde hatte einfach entschieden, dass Menschen in Spanien keinen Zugang zu einer bestimmten Website mehr haben sollten.
Oberster Gerichtshof kassiert Sperre
Rein technisch funktioniert eine Netzsperre wie eine Art Sichtschutz. Die gesperrten Webseiten bleiben weiter online, sie sind lediglich in einem bestimmten geografischen Gebiet nicht mehr zu sehen – zumindest nicht ohne entsprechende Werkzeuge. Wer sie umgehen will, kann beispielsweise ein VPN oder den Tor-Browser nutzen.
Freiwillige des Open Observatory of Network Interference (OONI), das mit Hilfe einer freien Software Netzblockaden untersucht, haben detailliert zusammengetragen, welche Internetanbieter mit welchen technischen Verfahren die Seite blockieren. Ihre Analyse zeigt, dass mindestens vier Verfahren zum Einsatz kommen – von einer eher zahmen Umleitung bis zur technisch versierten Blockade bestimmter Daten. Besonders weit gehen Vodafone und Telefónica. Sie haben sogar eine Technik namens Deep Packet Inspection angewandt, eine der invasivsten Technologien, um Inhalte zu blockieren. Sie kommt sonst vor allem in Ländern wie China, der Türkei oder Indien zum Einsatz, wo Massenabschaltungen des Internets gängige Praxis sind.
Auch rechtlich gelten Netzsperren als schweres Geschütz. Sie verletzen den Grundsatz der Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Daten bei der Übertragung im Netz und den freien Zugang dazu. Vor allem autoritäre Staaten machen von ihnen Gebrauch, um unliebsame Inhalte zu zensieren. In demokratischen Staaten sollten die Hürden deswegen hoch liegen, bevor dieses Mittel ausgepackt wird.
In Spanien schien die Hürde nicht ganz so hoch zu liegen. Die Arzneimittelbehörde konnte die Netzsperre einfach anordnen, Internetanbieter von Vodafone bis Orange mussten sich daran halten. Oder so schien es zunächst. Denn offenbar war diese Interpretation der Rechtslage etwas voreilig.
Women on Web klagte 2021 gegen die Sperre und bekam in Teilen recht. Im Oktober urteilte der Oberste Gerichtshof Spaniens, dass die Netzsperre gegen womenonweb.org nicht im Einklang mit dem Gesetz war. Die Behörde hätte zwar ohne richterliche Anordnung die Teile der Seite sperren dürfen, auf denen die Medikamente angeboten wurden, also die Seiten, auf denen Women on Web titelt „Bestelle Abtreibungspillen online“ – nicht aber die ganze Website.
Denn die Medikamentenabgabe sei zwar klar illegal, aber neben den Arzneimitteln finde man hier auch „Informationen, Empfehlungen und Meinungen zu sexueller Gesundheit und reproduktiven Rechten“. Diese Inhalte fielen „zweifellos in die Kategorie der Informationen und Meinungsäußerungen, so dass ihre Unterbrechung ohne vorherige richterliche Genehmigung nicht rechtmäßig erfolgen konnte“. Darüber hinaus übten Organisationen, die sich für die sogenannten reproduktiven Rechte einsetzen, eine Tätigkeit mit einer politischen Dimension aus. Da müsse man besonders auf die Meinungsfreiheit achten.
Das Urteil: Die Sperre der Seite als Ganzes müsse wieder aufgehoben werden. Nur die Teile, auf denen Medikamente angeboten werden, dürften weiter blockiert bleiben.
„Unfair und unaufrichtig“
Das war im Oktober. Geschehen ist danach erst mal lange nichts, berichtet die Anwältin Gema Fernández, die die Organisation vor Gericht in Spanien vertritt. Der Streit ging stattdessen weiter. Die Arzneimittelbehörde und die sie vertretende Staatsanwaltschaft hatten nun ein neues Argument: Es sei technisch unmöglich, das Urteil des Obersten Gerichtshofes umzusetzen. Denn wer die Website besucht, nutzt HTTPS, eine verschlüsselte Verbindung. Der Internetanbieter sieht nicht, welche Unterseiten eine Person aufruft und kann sie deshalb nicht einzeln blockieren. Deswegen müsse eben die gesamte Seite in Spanien gesperrt bleiben, um illegalen Handel mit Medikamenten zu verhindern.
Women on Web ist wütend. „Wir fühlen uns durch dieses Urteil in die Irre geführt und verraten“, sagt Venny Ala-Siurua, Geschäftsführerin von Women on Web in einer aktuellen Pressemitteilung. „Wir waren nie ganz zufrieden mit der Entscheidung, einen Teil unserer Seiten gesperrt zu halten. Aber zu erfahren, dass es nie eine echte Möglichkeit gab, unsere Seiten teilweise zu entsperren, fühlt sich sehr unfair und unaufrichtig an.“ Die spanische Regierung müsse die Seite sofort wieder freigeben, alles andere sei ein Verstoß gegen das Recht auf freie Information zum Schwangerschaftsabbruch.
Abbrüche: Legal und doch schwer zu bekommen
Schwangerschaftsabbrüche sind in Spanien seit 2010 nicht mehr kriminalisiert. Die damalige sozialdemokratische Regierung hatte den Kurs gewechselt und etabliert, dass jede Person auf Wunsch eine Schwangerschaft bis zur 14 Woche beenden kann. Vor kurzem hat die amtierende Regierung von PSOE und der linken PODEMOS den Zugang zu Abbrüchen noch weiter erleichtert, nun muss man sich vor dem Abbruch nicht verpflichtend beraten lassen. Auf dem Papier klingt die Situation besser als in Deutschland, wo der Abbruch immer noch im Strafgesetzbuch geregelt wird.
In der Praxis ist sie das offenbar nicht. Spanien ist ein katholisches Land. Ärzt:innen oder Krankenpfleger haben das Recht, einen Abbruch aus Gewissensgründen zu verweigern. Niemand weiß genau, wie häufig das geschieht – man muss die Verweigerung aus Gewissensgründen nicht melden. Feministische Organisationen berichten aber von bestimmten Regionen, etwa im andalusischen Süden, wo gar keine Abbrüche mehr angeboten werden. Die New York Times berichtete vor zwei Jahren, in der ganzen Region Aragonien im Norden des Landes gebe es keine einzige öffentliche Klinik, die noch einen Abbruch durchführt. Auch das Forschungsprojekt European Abortion Access verweist auf Studien, die zeigen, dass in bestimmten Regionen kaum noch eine Versorgung besteht.
Women on Web argumentiert: Schwangere in Spanien sind auf die Informationen auf ihrer Seite angewiesen, es gehe um ein Grundrecht.
Women on Web will vor das Verfassungsgericht
Der Streit geht weiter: Women on Web kämpft nicht nur mit der Arzneimittelbehörde um die Freigabe ihrer Website. Sie will auch das Urteil des Obersten Gerichtshofes nicht anerkennen, der Streit soll bis vors Verfassungsgericht.
„Die Entscheidung ist zwar weitgehend positiv“, sagt Gema Fernández. Und dennoch hatte das Gericht geurteilt, es sei illegal, dass Women on Web Medikamente abgebe, die in Spanien nicht zugelassen sind, „selbst wenn die Medikamente von einem Arzt in einem anderen EU-Mitgliedstaat verschrieben wurden“. Dagegen hat die Organisation Berufung eingelegt. Sie argumentiert, dass man erstens keine Medikamente verkaufe, sondern bei Bedarf nur den Kontakt zu Ärzt:innen herstellt. Diese würden dann die gleichen Medikamente verschreiben, wie sie auch in Spanien verschrieben würden. Zweitens seien die Medikamente entgegen der Auffassung des Gerichtes sehr wohl in Spanien zugelassen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde durch das Verfassungsgericht steht noch aus.
Die Situation ist paradox. Ausgerechnet das Verschlüsselungsprotokoll HTTPS, mit dem die Organisation den Besuch auf ihrer Webseite für ihre Nutzer:innen sicherer macht, sorgt jetzt womöglich dafür, dass die ganze Seite in Spanien gesperrt bleibt. Zu einem weniger sicheren Standard zu wechseln, sei für Women on Web aber keine Option, sagt Gema Fernández. Die Organisation bleibt bei ihrer Forderung: Die ganze Seite muss entsperrt werden.


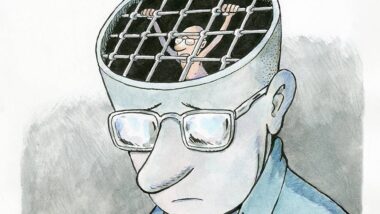


Vielen Dank für diesen erhellenden Bericht. Allen beteiligten viel Glueck in dieser Sache, die viel Aufmerksamkeit verdient.
Sollte das kippen, kann nicht laut EU-Gesetz (schon implementiert?) die ungarische Fischereiberhörde beispringen, und eine Sperrung wegen Terrorismus verlangen?
Oder ist das dann nur ein Geoblock für Ungarn?
Da stimmt etwas nicht: DPI (Deep Packet Inspection) kann auf einer verschlüsselten (https://) Verbindung gar nichts ausrichten – es sei denn, der Provider schleicht sich als MitM (Man in the Middle) in die Verbindung. Das allerdings würde einiges an krimineller Energie voraussetzen und wäre vermutlich illegal. Oder ist DPI Vergangenheit, aus der Zeit, bevor die Website verschlüsselt angeboten wurde? Hier würde ich mich über ein klärendes Update freuen.
Ansonsten stinkt die Affäre natürlich zum Himmel. Da kann Spanien seine katholische Vergangenheit nicht ganz ablegen. Und einen fadenscheinigen Vorwand findet man immer, wie im vorliegenden Fall den „illegalen“ Medikamentenverkauf.
Hoffen wir, dass die fortschrittlichen Kräfte gewinnen! Obwohl die Vorzeichen schlecht aussehen, wie in fast ganz Europa. :-(
Ja, DPI meint in die Pakete reinzuschauen.
Der Bericht von Magma via Open Observatory of Network Interference schreibt aber nicht, dass DPI konkret eingesetzt worden ist, sondern das DPI-Unternehmen lokalisiert worden sind, also, von mir unterstellt, Geräte von Fortinet und Allot. Um DPI zu belegen, müssten m.E. eine konkrete URL blockiert werden und eine andere nicht, von der selben Domain. Da über 404-Fehlerseiten in dem Bericht geschrieben wird, gehe ich vielmehr davon aus, dass die Domain festgestellt worden ist bei den Internet-Service-Provider (ISP) und dann uniso eine HTTP-Antwort mit einer 404-Webseite zurückgegeben wurde. Das ist technisch auch im DNS möglich, kann aber auch im Netzwerk von speziellen Routern erledigt werden.
Ich denke es sollte sich eine technische Lösung finden lassen, dass der „Webshop“-Teil auf einem anderen Server und einer anderen IP liegt, als das reine Informationsangebot.
Ob man das will, keine Ahnung. ich empfinde es als Falsch, dass hier überhaupt gesperrt wird und gut, dass hier weiter der Rechtsweg beschritten wird. Es ist auf jeden Fall besser, das gesellschaftliche Problem zu lösen als technisch zum umgehen. Sollte der sich als nicht erfolgversprechend erweisen muss man sich halt überlegen, welchen Aufwand man treiben will und wie wichtig einem zumindest der Zugang zu den Informationen aus Spanien ist.
Dann würde ich das Informationsangebot aber auch gleich um Informationen zum Tor-Browser ergänzen. Dazu noch einen onion-Seite auf die man als Einstieg verweist. Auf dieser Einstiegsseite packe ich dann noch einen Link zu dem „Webshop“ als onion Seite und man kann den betroffenen Frauen wieder helfen. (Den Zwischenschritt würde ich gehen um besser argumentieren zu können, nicht direkt auf vielleicht mal irgendwann illegale Informationen zu linken, die doch wieder eine Sperrung zur Folge haben.)
Wenn die Unterseiten nach höchstrichterlicher Rechtsprechung tatsächlich nicht spanischem Recht entsprechen, wieso blockiert die Organisation diese Unterseiten für Nutzer:innen aus Spanien nicht selbst?
Ob Netzsperren – insbesondere ohne vorherige richterliche Prüfung – die richtige Maßnahme sind, ist gleichwohl kritisch zu hinterfragen. Nachdem die richterliche Prüfung nun erfolgt ist, stellt man sich allerdings über den Rechtsstaat und muss dafür auch mit Kritik rechnen.
Dass eine Entscheidung vollstreckbar ist, bevor das Verfassungsgericht entschieden hat, sofern dieses den Fall überhaupt zur Entscheidung annimmt, spricht auch nicht gegen das Rechtssystem und ist in anderen Ländern wie Deutschland nicht anders.
Oder anders gesagt: Der richtige Weg wäre es die Organisation auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen und dies ggf. mithilfe von Rechtshilfeabkommen beispielsweise mit Zwangsgeldern zu vollstrecken.
Falls es nicht nur schwierig sondern absolut unmöglich sein sollte hierfür Rechtshilfe zu erhalten, können Netzsperren auf DNS-Basis nicht per se als illegitim betrachtet werden.
Die Lösung liegt doch auf beiden Seiten.
Nun ist erstmal juristisch der Rahmen geklärt, und ermöglicht der Organisation Ihr Webangebot anzupassen.
Wie schon zuvor geschrieben, wenn man klug und nicht dogmatisch agiert, muss das Informations- und Vermittlungsangebot auf getrennte Server/Hoster.
Auch das erwerben neuer Domains, in landessprache, mit .es Endung, die erstmal auf eine Alternative Domain routen, sollte versucht werden, denn, wie viele Webseiten wollen die denn sperren, wenn dort nur noch informiert wird, aber eben nicht mehr vermittelt wird. Da kommen die mit den Sperrverfügungen weder personell noch rechtlich weiter, betrachtet man das aktuelle Urteil.
Das Informationsangebot sollte nicht nur auf https, sondern auch über http zu erreichen sein, und parallel packt man die Inhalte dann noch auf alle sozialen Plattformen.
Ich würde empfehlen auch Geld für einen Werbespot im spanischen Fernsehen, per Crowdfunding, zu sammeln, um auf das Informationsangebote hinzuweisen.
Kurz, während die Prinzipienreiter auf beiden Seiten sich vor Gericht Ihre Lebenszeit rauben, sollte man draußen mit allen Mitteln weiter Fakten schaffen.
„Wie schon zuvor geschrieben, wenn man klug und nicht dogmatisch agiert, muss das Informations- und Vermittlungsangebot auf getrennte Server/Hoster. “
Dogmatisch hat damit eigentlich nichts zu tun. Ich hätte die Dienste bereits nach Standardkalkül voneinander getrennt, ALLERDINGS gibt es mindestens zwei Gegenargumente:
1. Justiz blosstellen, indem dieses Urteil fällt.
2. Es wird sowieso geklagt, und dann als eines eingestuft, wonach dann das eine ohne Bezug auf das andere dastehen muss, wenn die Justiz noch so tickt. So kann man sich logische wie physische Server erst mal sparen, eben bis das juristisch geklärt ist (zzgl. siehe 1.). Immerhin wäre dann schon eine Verlinkung sonst ein Risiko, was durchaus Konsequenzen für das Ganze haben kann. Insofern ist der harmlosere Fall für den Schlachttisch erst mal, ein integriertes System zu bauen.
Es könnte also verschiedene Ebenen von Klugheit geben, wobei ich mir nicht anmaßen will zu behaupten, der unter 2. beschriebene Seitenfall wäre eine solche.