Zu viele Kommunen kennen das Spiel: Kaum entschließt sich ein Netzbetreiber, ein Gebiet endlich mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen, kündigt plötzlich ein Konkurrent an, ebenfalls ausbauen zu wollen. Im besten Fall werden dann die Straßen mehrfach aufgerissen, um neue Leitungen zu legen. Im schlimmsten Fall zieht sich das erstausbauende Unternehmen teilweise oder ganz zurück, weil die wirtschaftliche Mischkalkulation nicht mehr aufgeht – während sich das andere Unternehmen die Rosinen in dicht bebauten Gebieten herauspickt.
Schon seit Jahren geistert das als „Überbau“ bekannte Phänomen durch den deutschen Telekommunikationsmarkt. Bislang wusste aber niemand so recht, wie weit verbreitet das Problem eigentlich wirklich ist. Das beginnt sich nun langsam zu ändern: Unter anderem sammelt inzwischen eine Monitoringstelle Fälle von doppelten Glasfaserausbauvorhaben, um sich erstmals einen belastbaren Überblick zu verschaffen.
Hunderte Fälle von Überbau
292 Rückmeldungen sind seit dem Start im Juli bei der Monitoringstelle eingegangen, teilte kürzlich die gemeinsam von Bundesnetzagentur (BNetzA) und Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) eingerichtete Stelle den Mitgliedern des BNetzA-Beirats mit. Indes können sich dabei mehrere Rückmeldungen auf das gleiche Ausbaugebiet beziehen, die Zahl der betroffenen Gebiete dürfte niedriger liegen.
Aber die Momentaufnahme zeigt: Die Fälle sind durchaus real und könnten zum Problem werden, wenn sie überhand nehmen oder der Überbau strategisch erfolgt. Ebenfalls problematisch: Rund 15 Prozent der Meldenden gab an, dass das von einem doppelten Ausbauvorhaben betroffene Glasfasernetz mit Fördermitteln errichtet werde beziehungsweise worden sei. Das überbauende Unternehmen ist also erst dann tätig geworden, als beispielsweise klar wurde, dass ihm Marktanteile wegzubrechen drohen – und zugleich gefährdet es die Wirtschaftlichkeit des subventionierten Projekts.
Noch stehen weitere Befunde aus. Zunächst gehe es darum, „ähnlich gelagerte Fälle zu bündeln und Muster ggf. zu beanstandender Praktiken zu identifizieren“, heißt es in dem Bericht an den BNetzA-Beirat. „Dazu könnten zum Beispiel Praktiken zählen, die durch Ausnutzung einer marktmächtigen Stellung speziell darauf abzielen, Konkurrenten vom eigenen Ausbau abzuschrecken“, heißt es weiter – ein kaum kaschierter Hinweis auf die marktmächtige Telekom Deutschland, die sich seit Jahren diesem Vorwurf ausgesetzt sieht. Eine wettbewerbliche Bewertung der unterschiedlichen Fallkonstellationen werde aber erst in einem zweiten Schritt erfolgen, so der Bericht.
Studie soll Bild abrunden
Dabei dürfte die BNetzA auch auf eine aktuelle, nicht repräsentative Studie des Forschungsinstituts WIK-Consult zurückgreifen. Im Auftrag des BMDV untersuchte das Institut 93 konkrete Fälle von Überbau reiner Glasfasernetze – samt einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einordnung sowie dem Aufzeigen regulatorischer Handlungsoptionen.
Demnach ist Überbau in Ballungsräumen kein sonderliches Problem, solange die Marktanteile der jeweiligen Netzbetreiber relativ gleichmäßig verteilt sind. Allzu oft ist das aber nicht der Fall. Und ganz anders sieht die Lage im restlichen Bundesgebiet und vor allem in weniger dicht besiedelten Gebieten aus.
Rund zwei Drittel aller Haushalte liegen in Gegenden, in denen der Infrastrukturwettbewerb seine ökonomischen Grenzen erreicht, konstatiert die Studie. Dort lässt sich gerade Mal ein Netz wirtschaftlich betreiben oder braucht staatliche Förderung, weil es sich sonst nicht lohnt. Allein die Ankündigung eines Wettbewerbers, parallel ein neues Netz bauen zu wollen, wirft in der Regel die ursprünglichen Pläne des erstausbauenden Unternehmens über den Haufen.
Glasfaser-Euphorie könnte versiegen
So verwundert es kaum, dass sich in der Branche zunehmend Verunsicherung breit macht. In den letzten Jahren flossen zwar Milliardenbeträge in den privaten Ausbau von Glasfasernetzen, weil sich Investoren stabile Erträge erhofften. Die Aussicht auf 50 Milliarden Euro an privaten Investitionen, die die Branche für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt hatte, gilt als integraler Bestandteil der Gigabitstrategie von Digitalminister Volker Wissing (FDP).
Doch das Klima habe sich zuletzt merklich abgekühlt, berichtet das Handelsblatt (€). Interne Planzahlen würden nicht erreicht oder Projekte würden gestoppt, soll es aus der Branche heißen. Probleme auf der letzten Meile würden den Ausbau verzögern, zudem liege in manchen Ausbaugebieten die Vorvermarktungsquote bei läppischen 15 Prozent – viel zu wenig, um Projekte wirtschaftlich zu machen. Kleineren Unternehmen drohe die Pleite, so das Handelsblatt.
Fragwürdiger Überbau
Ein mehrfacher Ausbau des gleichen Gebiets hilft da kaum weiter. Zum einen sei Überbau „technisch nicht notwendig“, da Glasfaser eine höchst leistungsfähige Technologie sei, sagt die Grünen-Abgeordnete Tabea Rößner gegenüber netzpolitik.org. Zum anderen ist „Überbau volkswirtschaftlich fragwürdig und sollte auch aus Gründen des Ressourcenschutzes und vor dem Hintergrund begrenzter Baukapazitäten sowie dem Fachkräftemangel verhindert werden“, so die Vorsitzende des Digitalausschusses.
Allerdings sei es weiterhin wichtig, eine bessere Datengrundlage zu bekommen, um die „tatsächliche Dimension des Problems besser zu erfassen“, weist Rößner auf die laufende Untersuchung der Monitoringstelle Doppelausbau hin. Sollte sich der Überbau im Monitoring als breites Problem herausstellen, dann könnte die BNetzA bestimmtes Verhalten untersagen oder zumindest die Anreize dafür deutlich reduzieren – etwa über eine verschärfte Missbrauchsaufsicht oder mit Open-Access-Auflagen.
Derweil gibt sich das BMDV betont unbeeindruckt. „Aus Sicht des BMDV ist tatsächlicher oder angekündigter Überbau nicht per se ein Problem“, gerade in dicht besiedelten Gebieten, teilt ein Sprecher des Ministeriums mit. Auch sei ein „Überbauverbot“ derzeit nicht vorgesehen und „wird im Übrigen seitens der Branche auch kategorisch abgelehnt“, so der Sprecher. Die BNetzA wollte sich auf Anfrage nicht zu der Thematik äußern.
Branche sieht mehr Regulierung skeptisch
Tatsächlich weist die Telekom Deutschland die Vorwürfe von sich. Überbau sei kein weitflächiges Problem, sondern würde in weniger als einem Prozent des Ausbaugebiets stattfinden, führt etwa der Regulierungsexperte des Marktführers, Wolfgang Kopf, in einem Blogeintrag aus. Die Antwort auf die Probleme sei mehr Kooperation unter den Anbietern und ein standardisierter, offener Netzzugang mittels Open Access.
Auch der Branchenverband BREKO, der hunderte Wettbewerber des Ex-Monopolisten vertritt, fordert eher mehr Transparenz als harte gesetzliche Auflagen: So sollte die Telekom als marktbeherrschendes Unternehmen etwa verpflichtet werden, ihre Glasfaser-Ausbauplanung neun Monate im Voraus –– nicht öffentlich –– bekannt zu geben. Das soll ausschließen, dass das Unternehmen kurzfristig auf Ausbauplanungen von Wettbewerbern reagieren kann.
Warten auf Branchen-Einigung
Für den digitalpolitischen Sprecher der FDP, den Bundestagsabgeordneten Maximilian Funke-Kaiser, kommt jedenfalls in Frage, dass in Zukunft „vermehrt über gebietsspezifische Maßnahmen zur Eindämmung von Überbauaktivitäten nachgedacht werden wird“. Allerdings könne Open Access zur Beschleunigung des Glasfaseraubaus in Deutschland beitragen und der Überbau-Problematik begegnen, so Funke-Kaiser zu netzpolitik.org: „Ich warte mit Spannung auf den Statusbericht zur Diskussion über Prinzipien eines marktweiten Open Access, die das Gigabitforum aktuell erarbeitet“.
Doch der Bericht, der für das zweite Quartal 2023 angekündigt war, lässt weiterhin auf sich warten. Das offene Zugangsmodell, das in Ländern wie Schweden seit Langem erfolgreich praktiziert wird, steckt hierzulande immer noch in den Kinderschuhen. Bis sich die Branche und Politik auf verbindliche Regeln geeinigt haben, dürfte es wohl weitergehen wie bisher: „Am Ende des Tages sind wir einfach schneller, wenn wir überbauen“, klagte letztes Jahr ein Netzbetreiber bei einer Anhörung im Bundestag.

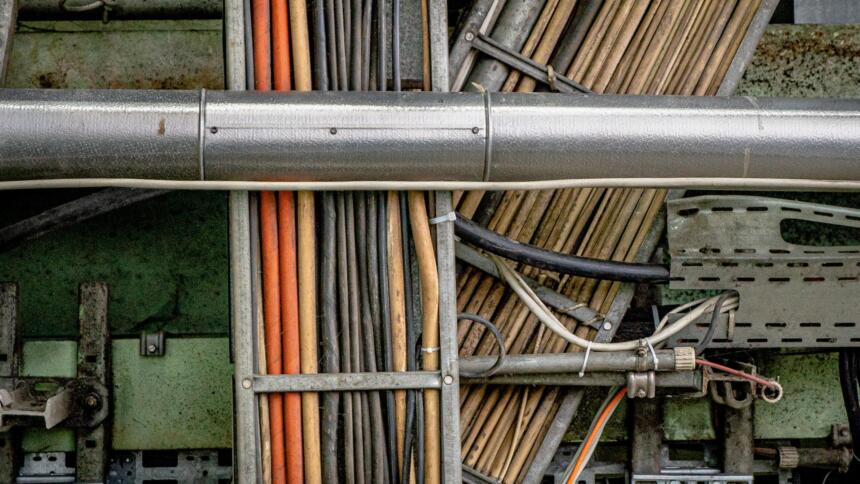



Die Bundesregierungen jeder Coleur sehen Infrastruktur halt primaer als zu privatisierendes Gewinnpotential, kann man nichts machen.
Schon krass, wenn man sich vor Augen fuehrt, dass wir heute praktisch nichts der fuer uns so selbstverstaendlichen und fuer unseren allgemeinen Lebensstandard notwendigen Infrastruktur des letzten Jahrhunderts aufbauen koennten. Wir waeren mit der heutigen Politik ein Chile, nichtmal ein Brasilien.
Das ist auch so gewollt, Chile ist für das reichste 1% durchaus toll.
Warum die Mehrheit der deutschen Wähler jenseits dieser 1% das unbedingt will allerdings…
Telekom tut Telekom-Dinge. Warum überlassen wir private Unternehmen nochmal den Ausbau unserer öffentliche Infrastruktur?
Meine Zusammenfassung: Wer Gemeinnützigkeit will, darf diese nicht dem Kapitalismus überlassen. Das gilt für jede Leitung-gebundene Infrastruktur. Welche Rolle spielt dabei die Netzagentur? Das konnte mir bisher niemand schlüssig erklären.
Das Problem ist wie so oft die bisherige gesetzliche Lage: Der Netzbetreiber, der den Boden aufstemmt, wird dazu verpflichtet, alle anderen gleich ihre Leitungen ebenfalls verlegen zu lassen. Das sorgt zum einen dafür, dass jeder Netzbetreiber wartet, bis für einen Konkurrenten der Leidensdruck zu groß wird und er die Kosten für die Tiefbaumaßnahmen übernimmt, und zum anderen führt es dazu, dass die Rentabilität ebendieser Investition geschmälert wird, weil die Konkurrenz mit ihren subventioniert verlegten Leitungen nun noch Kundschaft für sich abzweigt.
Die Situation illustriert aber auch wieder einmal, wie schlecht „Wettbewerb“ bei natürlichen Monopolen wie physischen Netzen funktioniert, und was für eine schlechte Idee es ist, derartige Infrastruktur in private Hände zu geben. Es bräuchte ein Netz in öffentlicher Hand, welches dann verschiedenen Anbietern zur Nutzung zur Verfügung gestellt würde, die miteinander konkurrieren könnten.
>> Ausbaugebieten die Vorvermarktungsquote bei läppischen 15 Prozent
nach Berichten und Klagen aus der Nachbarschaft über aggressive Haustürvertreter in Sachen FTTH Vorvermarktungsquote wurde nun beschlossen alle (ausnahmslos alle ) diese „Treppenhausterrier“ vom Hof zu jagen.
Beispiel: Vertreter : Wir kommen im Auftrag des (Name der FTTH) Anbieters :) und müssen jetzt mal deinen Router sehen. LOL
Nachbar: leicht säuerlich : Wir kaufen nix und das DUZEN lassen SIE! mal schön. Ansonsten kommt heute abend noch die Zahnfee zu Ihnen :-(;),,,|
Bei drei FTTH Anbietern und einer Wohnanlage mit ~200 Mietparteien ist so richtig wat los im Treppenhaus. (zwei bis drei Kontaktversuche pro Tag (Sonnabend und Sonntags nie)
Der Branchenverband BREKO, der hunderte Wettbewerber des Ex-Monopolisten vertritt, sollte von Gesetzgeber verlangen, das solche „Direktvertriebsmethoden seitens seiner Mitglieder“ in Sachen FTTH verboten werden. Die Belästigung von „Millionen von Kunden“ ist scheinbar aber integraler Bestandteil der Gigabitstrategie des sogenannten Digitalministers Volker Wissing (FDP).
Zum einen gab es immer wieder Berichte, dass, wenn eine Gemeinde sich entschlossen hatte, ihr Dorf in Eigenarbeit mit dem Internet zu verbinden, ganz plötzlich die Telekom die Gegend doch interessant fand, und doch anschloss. Das Vorgehen ist nicht neu.
Aus der Zeit stammt die Insider-Regel:
„Wer zuerst gräbt hat verloren“.
Um solche „Kriegsgräben“ zu vermeiden, gab es eine zeitlang die Regel, dass man, wenn wer schon die Erde aufgemacht hat, dort hinein sein eigenes Kabel (Leerrohre) legen darf.
Das hat wegen o.g. Regel auch nicht funktioniert…Wenn die Telekom gebuddelt hatte waren die Löcher sofort wieder zu.
Jetzt sehe ich dicke orange Kabeltrommeln wochen,monatelang an den Löchern stehen.
Gemeinde „türkten“ dann Vernetzungs Vorhaben. Das soll wohl da und dort funktioniert haben. Allerdings sitzen Telekom Mitarbeiter auch in der ehrenamtlichen örtlichen Verwaltung, privat.
Es wurde in den 1990 kolportiert,dass die Telekom ihren Mitarbeitern empfohlen hat, an solchen Einrichtungen teilzunehmen und auch entsprechend zu unterstützen…
Wie man ein Monopol erhält, weiß die Telekom, wusste auch schon ihr Vorgänger, die Graue Post.
(z.B. mussten laut Pflichtenheft Kabel TV Vernetzung so aufgebaut sein, das sie nur in einer Richtung funktionierte und ein Umbau praktisch unmöglich sein musste. Das zahlte sich mehrfach aus. Z.B. ließ sich das BK Netz nicht so einfach verkaufen wie RegTP das damals beim Zerschlagen der Grauen Post gerne gehabt hätte. Ein Käufer hätte erstmal alle Verstärker und übergabe stellen austauschen müssen um Internet machen zu können.
Haben sie dann.
Erst wurde der Telefonmarkt im neoliberalen Sinne privatisiert dann gab es in der Tat einen gewissen Wettbewerb und die Netze wurden geöffnet. Jetzt versucht die Telekom sich überall von Kommunen das Glasfaser Netz bauen zu lassen um es dann für einige Zeit zu mieten….vorher allerdings jagen völlig unseriös und nötigend ganze Armeen von Klingenputzern durch die Ausbauviertel um den Leuten viel zu teure Telekomverträge aufzudrücken….viele ältere Personen werden brutal unter Druck gesetzt…..nach dem Motto ohne Glasfaser Anschluss ist ihre Immobilie nichts mehr wert etc. Bei mir standen sie insgesamt (bis heute) 5x mal vor der Tür jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr auf die Glasfaser………die telekom beschäftigt meiner Meinung nach völlig unseriöse Fa. die mit Telekom Kostümierung versuchen Bürger in überteuerte Verträge zu drängen…..wenn schon die Kommune das Glasfaser finanziert…..erwarte ich freie Anbieterwahl…sprich so wie das Kabel im Boden ist….möchte ich entscheiden mit welchem Anbieter ich surfe. Ungeheuerlich wie die Telekom agiert und kommunale Politik einsetzt. Hier wird Zeit das die EU eingreift.
Klar hat auch die Telecom vitale Interessen, Umsatz zu machen.
Ich bin bei Telekom mit Internet und Festnetz.
Nebenbei: Vodafon wollte unser Dorf (400 Einwohner) verkabeln, hatte überall ihre Plakate hängen. Jetzt hängen sie nicht mehr.
Warum? Weil Telecom da, wo gebuddelt werden soll, dem potentiellen Nutzer eine G5 Antenne mit allem Drum und Dran anbietet, da muß keine Straße mehr kaputt gemacht werden.
Mehr Leistung braucht so gut wie keiner.
Das Ganze erinnert mich an einen Schildbürgerstreich.
Nachteile von Funklösungen ganz generell:
Sie sind prinzipiell vielfach störanfälliger gegenüber Kabellösungen.
Bei der G5 Technologie gibt es Anlass zum Zweifel an der Abhörsicherheit (vgl. Huawei Debatte, von wem wollen wir uns abhören lassen).
Welche Haushalte brauchen Glasfaser?
Eigentlich nur jene, bei denen mehr als eine Anwendung Media-Streaming gleichzeitig höchste Auflösungen fordern. Würde die beworbeneBandbreite vom ISP, beim Kunden immer tatsächlich zur Verfügung stehen, könnte man schon ab 50mbit/s ruckelfrei Streams empfangen. Ganz sicher aber bei 100Mbit/s.
Problem der Kupfer-Infrastruktur:
Wenn zuviele Nutzer gleichzeitig HD-Streams empfangen wollen, dann reicht die Kapazität nicht mehr für alle. Drosseleffekte werden beim Nutzer erlebbar, d.h. es reicht nur noch für geringere Auflösungen.
Fazit:
Haushalte haben nur dann ein Problem, wenn sie glauben sie müssten unbedingt gestreamtes Fernsehen oder Netflix wollen und das immer in höchsten Auflösungen und in jedem Kinderzimmer gleichzeitig.
Gestern war son Telekom-Fuzzy da, der uns die frohe Botschaft über nen Glasfaserausbau überbringen und gleich nen Vertrag andrehen wollte.
Meinte, wenn wir den Vertrag nicht jetzt abschließen, wird unser Haus nicht angeschlossen. Ich hab erklärt, dass ich jetzt nicht ohne Weiteres nen teuren Vertrag unterschreiben werde.
Er meinte, dass wir mit Glasfaser viel höhere Geschwindigkeiten hätten und alles viel besser wäre, worauf ich sagte, dass wir mit dem Durchsatz den wir bekommen zufrieden sind und ich zwar Glasfaserausbau grundsätzlich sehr gut finde, allerdings als Mieter nur finanzielle Nachteile für uns sähe.
Dann erklärte er, dass wir die im Vertrag stehenden Durchsatzzahlen ja gar nicht bekämen, worauf ich beschrieb, dass ich das regelmäßig messe, weil ich auch scharf drauf bin, mein Recht wahrnehmen zu können, dann noch weniger bezahlen zu müssen, aber die Minimalwerte leider eingehalten werden.
Danach drängte er dann, dass ich ihm meinen Vertrag mit 1&1 zeigen solle, damit er mich dann beraten könne. Ich sagte, dass ich die Fürsorglichkeit zu schätzen wisse, aber nicht dass Bedürfnis habe, mit ihm zusammen meinen Vertrag mit der 1&1 durchzugehen. Die Konditionen im Vertrag hatte ich ihm erklärt, aber er wollte mir weismachen, dass ich diese bestimmt ganz falsch verstanden hätte (hab ich nicht!).
Schließlich fing er an, Geschichten zu erzählen, dass ja der Durchsatz, den man aus der Dose bekommt nur die eine Sache wäre, aber wir ja via WLAN wahrscheinlich weniger bekommen und das mit Glasfaser viel besser werden würde. Da hab ich ihn dann höflich rausgeworfen.
Dabei meinte er dann noch, dass er auch mal für 1&1 gearbeitet habe, aber aus Gewissensgründen gewechselt hätte, weil er ihre Vertragsvergabe so schändlich fand. Ich sagte, dass ich diese merkwürdigen Angebote auch blöd finde, aber dass das bei der Telekom leider genauso ist. Zumindest das gab er dann irgendwie auch zu
Beim Glasfaserausbau fordert die Privatwirtschaft deutlich weniger staatliche Fördermittel als bisher vorgesehen. Auch die Digitalverbände Bitkom und VATM nahmen diese Haltung ein.
Den Unternehmen, die diese Verbände repräsentieren, ist die staatliche Förderung schon seit Langem ein Dorn im Auge. Sie monieren, dass die knappen Baukapazitäten dadurch für staatlich gestützte Vorhaben abgezogen werden.
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/glasfaser-ausbau-provider-wollen-weniger-staatsgeld-a-7103d185-5e6a-42f5-8f57-e123b4940a79