Der wissenschaftliche Autor und Aktivist Tilman Santarius beschäftigt sich mit Klima- und Handelspolitik, nachhaltigem Wirtschaften, globaler Gerechtigkeit und digitaler Transformation. Derzeit lehrt er an der TU Berlin und leitet eine Nachwuchsforschungsgruppe zum Thema Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. In seinem Buch „Smarte Grüne Welt?“ fragt er, was die Digitalisierung für Ökologie und soziale Gerechtigkeit bedeutet und wie sie sich auf Arbeitsplätze, Einkommensverteilung und Ressourcen auswirkt. Santarius war einer der Initiatoren der Konferenz „Bits & Bäume“. Ehrenamtlich ist er im Aufsichtsrat bei Greenpeace Deutschland aktiv.
Am 3. und 4. Dezember 2018 hatte die Bundesregierung zum Digitalgipfel in Nürnberg geladen. Auf der Agenda stand die Gestaltung des digitalen Wandels – mit dem erklärten Ziel, dass Wirtschaft und Gesellschaft den besten Nutzen aus der Digitalisierung ziehen sollten. Doch es fällt auf: Drängende soziale, arbeitsmarktpolitische oder gar ökologische Herausforderungen standen gar nicht auf der Agenda des Gipfels.
Zwei Wochen zuvor, vom 17. bis 18. November, haben sich rund 2.000 Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Verbände in Berlin auf der Konferenz „Bits & Bäume“ zusammengefunden. Dort ging es um eine Gestaltung der Digitalisierung, die soziale und ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum stellt. Die zentrale Botschaft von dieser Konferenz: Es braucht dringend eine sozial und ökologisch ausgerichtete Digitalpolitik, damit die Digitalisierung einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen leistet. Der Vergleich des Digital-Gipfels der Bundesregierung und der Bits-und-Bäume-Konferenz als weitgehend unverbundene Groß-Events zeigt: Es bestehen grundsätzlich verschiedene Ansichten darüber, ob Digitalisierung von allein, sozusagen „automatisch“ einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt, oder ob sie hierfür seitens Politik, Unternehmen und auch Nutzerinnen und Nutzern aktiv gestaltet und gesteuert werden muss.
Folgt man den Worten diverser Initiativen der Bundesregierung, dann geht es bei der Digitalisierung vor allem ums „Gas geben“, ums rasche, radikale Durchdigitalisieren. Die Hoffnung: Damit würde Deutschland fit gemacht für die Herausforderungen unserer Zeit. Mit der „Plattform Industrie 4.0“ zum Beispiel hat das Bundeswirtschaftsministerium schon vor einigen Jahren die industriepolitische Strategie lanciert, die Stärke der deutschen Wirtschaft als Fabrikausrüster der Welt durch cyber-physische Systeme auszubauen. Damit sollen Wachstum und Beschäftigung gesichert werden. Oder: Mit dem Aufbau des 5G-Mobilfunkstandards möchte das Verkehrsministerium den Weg für die Einführung selbstfahrender Autos ebnen. Angeblich soll dadurch der Verkehr auch klimafreundlicher werden.
Schließlich hat die Bundesregierung jüngst ein Eckpunktepapier für eine Strategie zur Künstlichen Intelligenz (KI) vorgelegt. Erfreulicherweise heißt es darin nicht nur, dass KI-Anwendungen „Made in Germany“ zum neuen Exportschlager der Wirtschaft avancieren, sondern auch, dass mittels KI für alle Bürger*innen Sicherheit und Nachhaltigkeit verbessert und gleichzeitig soziale Teilhabe, Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung gefördert werden sollen.
Die größte Herausforderung: Die neuen Jobs
Aber stimmt es überhaupt, dass Industrie 4.0 anhaltendes Wirtschaftswachstum bringen und Arbeitsplätze sichern wird? Dass selbstfahrende Autos der dringend erforderlichen Verkehrswende dienen? Dass KI die Gesellschaft sozial und ökologisch zukunftsfähig machen wird? Eine andere Frage ist, ob den wohlmeinenden Worten bisher Taten gefolgt sind. Bedauerlicherweise hat die Politik auf regulatorischer Ebene bisher alles in allem eine reaktive Rolle gespielt. Beispielsweise wurden einige Dienste von Uber in Deutschland verboten, als das Taxigewerbe rebelliert hat. Oder die EU-Kommission hat gegen Google eine deftige Strafe verhängt, weil das Unternehmen Suchergebnisse manipuliert hat.
Eine transformative politische Strategie jedoch, die die Digitalisierung mit den Herausforderungen einer sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung zusammendenkt, fehlt bislang. Wenn Deutschland und Europa in der Digitalisierung weder dem chinesischen Modell folgen möchten, das auf Überwachung und „social scoring“ setzt, noch dem US-amerikanischen, das allein die Kapitalakkumulation vor Augen hat, dann bedarf es einer transformativen Digitalpolitik, die die Digitalisierung auf der Basis der Menschenrechte und von nationalen und internationalen Sozial- und Umweltstandards lenkt und gestaltet.
In sozialer Hinsicht stellt sich die Frage, ob die Digitalisierung der Wirtschaft zwar kurz- und mittelfristiges Wachstum bringen wird, langfristig aber der Sicherung gesellschaftlicher Teilhabe und Gerechtigkeit eher zuwiderläuft. Berichten von Unternehmensberatungen zufolge soll die „Industrie 4.0“ in Deutschland in den nächsten zehn Jahren jährlich etwa ein Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen und dreißig Milliarden Euro zusätzliche Gewinne für die Unternehmen bringen. Doch die meisten wissenschaftlichen Szenarien deuten darauf hin, dass sich einige der digitalen Innovationen deutlich anders auswirken könnten als vorherige Wellen der technologischen Entwicklung.
Der erste wichtige Unterschied: Die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen kommt viel schneller als zu Zeiten beispielsweise des Ausbaus der Eisenbahn oder der Einführung des Stroms im 19. Jahrhundert. Folglich gehen etliche Studien davon aus, dass allein in den nächsten beiden Jahrzehnten netto – als auch unter Anrechnung neu entstehender Jobs – zwischen „nur“ zehn Prozent oder gar über vierzig Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen könnten.
Ein zweiter wichtiger Unterschied: Die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung betrifft nicht nur wie zur Frühindustrialisierung das Handwerk der Weber, dann später jenes der Bauern oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Schicksal von Fabrikarbeiter*innen, sondern alle Berufsgruppen – vom Busfahrer bis zur Buchhalterin, vom Postbeamten bis zur Professorin.
Drittens, und das ist größte Herausforderung: Die neuen Jobs, die mit der Digitalisierung entstehen, werden nur zum geringeren Teil im Hochlohnbereich liegen, beispielsweise bei Programmierer*innen oder IT-Ingenieur*innen. Die große Mehrheit der Jobs wird jedoch im Niedriglohnsektor entstehen, etwa bei Lieferdiensten, in den Lagerhallen der Shopping-Plattformen oder in Form von Gelegenheitsjobs für Click-Worker.
Normalarbeitszeit weiter senken
Alles zusammengenommen kann die Digitalisierung der Wirtschaft dazu führen, dass die Einkommensschere weiter auseinandergeht. Die Gesellschaft droht in wenige Gewinner und viele Verlierer gespalten zu werden. Wird da nicht gegengesteuert, dann entsteht ein digitaler Neofeudalismus, bei dem sich einige wenige – die Macher und Besitzer*innen der Roboter und Algorithmen – zu Lasten der großen Mehrheit bereichern. Es ist leicht vorstellbar, wie dies den bereits aufkeimenden populistischen Strömungen weiteren Zulauf beschert, die eine vernunftgeleitete Politik vereiteln und die Gesellschaft auch in politischer Hinsicht weiter spalten werden.
Eine sozial-ökologische Digitalpolitik wird daher versuchen, langfristig tragfähige Rahmenbedingungen für die digitale Ökonomie von morgen zu setzen. Auf dem Arbeitsmarkt wird es darum gehen, den Umfang der Normalarbeitszeit weiter zu senken. Von den Zeiten der Frühindustrialisierung, als Menschen noch in einer Sieben-Tage-Woche mit 16-Stunden-Schichten schuften mussten, bis zur heutigen 40-Stunden-Woche haben wichtige Reformen bereits dafür gesorgt, dass der technologische Fortschritt nicht nur den Arbeitgeber*innen, sondern auch den Arbeitnehmer*innen zugute kommt.
Wenn künftig Kollege Roboter weitere Tätigkeiten ersetzt, wird eine Verkürzung der Normalarbeitszeit einer Vollzeitstelle auf 32 oder gar 24 Stunden pro Woche Sinn ergeben, damit möglichst viele Menschen ihre materiellen Lebensgrundlagen weiterhin aus eigener Kraft sichern können. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) birgt ebenfalls transformatives Potential. Doch sollten „Roboter plus BGE“ nicht dazu führen, dass die Gesellschaft in wenige Macher*innen und eine steigende Mehrheit von „Ruhiggestellten“ zerfällt. Schließlich ist Erwerbsarbeit für viele Menschen auch eine zentrale Quelle der Zufriedenheit und des Gefühls der gesellschaftlichen Zugehörigkeit.
Eine sozial-ökologische Digitalpolitik wird ferner eine Reform der Unternehmensverfassung ins Auge nehmen. Derzeit lässt sich beobachten, wie einige wenige Plattformanbieter (Facebook, Google, Amazon, Uber, AirBnB u. a.) Milliarden scheffeln. Doch es gibt keinen triftigen Grund, warum digitale Plattformen dem Gemeinwohl am besten dienen, wenn sie vor allem der Kapitalakkumulation einiger weniger Firmenchefs und Aktionär*innen dienen. Eine Unternehmensreform kann sicherstellen, dass digitale Plattformen kooperativ organisiert sein müssen, zum Beispiel genossenschaftlich. Beispiele wie Fairmondo, Etsy, die TransUnion Taxi App und viele andere machen vor, dass das bestens funktioniert.
Ferner sollte steuerpolitisch sichergestellt werden, dass die Automatisierungs- und Plattformgewinne zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben angezapft werden, damit die Allgemeinheit daraus einen Nutzen zieht. Derzeit zahlen große Konzerne wie Google oder Apple in Europa weniger Steuern als durchschnittliche Angestellte. In Deutschland werden teils gar keine Steuern eingenommen, obwohl die Unternehmen für ihre Geschäfte laufend öffentliche Infrastrukturen wie Breitbandnetze oder Straßen in Anspruch nehmen. Eine transformative Digitalpolitik wird also dafür sorgen, dass die IT- und Plattformökonomie nicht länger Trittbrett fährt, sondern sich aktiv an der Pflege des öffentlichen Gemeinwesens beteiligt.
Auch mit Blick auf die großen ökologischen Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, Energiewende, schwindende Ressourcenbestände usw. – birgt Digitalisierung Chancen, aber auch Risiken, wenn sie nicht aktiv gestaltet wird. Zunächst sind hier die immensen ökologischen Fußabdrücke der Geräte und digitalen Infrastrukturen zu nennen. Beispielsweise wurden allein für die Produktion der rund sieben Milliarden Smartphones, die in den zehn Jahren seit Einführung des ersten iPhones im Jahr 2007 auf den Markt kamen, 38.000 Tonnen Kobalt, 107.000 Tonnen Kupfer, 157.000 Tonnen Aluminium und tausende Tonnen weiterer Materialien verbaut, die teils unter fragwürdigen Umwelt- und Sozialstandards in Ländern des globalen Südens abgebaut werden.
Doch Smartphones sind nur ein Gerät unter vielen. Vor allem der Aufbau der rapide wachsenden Zahl an Rechenzentren verbraucht Millionen Tonnen an Ressourcen. In der Nutzung verbrauchen digitale Geräte dann vor allem Strom. Der Verbrauch des Internets beläuft sich bereits heute auf rund zehn Prozent der weltweiten Stromnachfrage und könnte bis zum Jahr 2030 auf dreißig oder gar fünfzig Prozent ansteigen – je nachdem, wie stark wir weiter zulegen bei der Digitalisierung. Es gibt derzeit keine Antwort auf die Frage, wie die materielle Basis der Digitalisierung durch nachwachsende Rohstoffe oder Einbindung in eine Kreislaufwirtschaft eines Tages nachhaltig werden könnte.
Energiestandards festschreiben
Ein wichtiger Eckpfeiler einer sozial-ökologischen Digitalpolitik wird daher die Entwicklung einer Designrichtlinie für IT-Geräte sein. Darin könnten Energiestandards für Rechenzentren und Endgeräte festgeschrieben werden, die im Zeitverlauf dynamisch verschärft werden – ähnlich wie dies bei Glühbirnen erfolgreich geregelt wurde. Es sollten Standards gesetzt werden, dass Geräte grundsätzlich modular aufgebaut und reparierbar sind; damit Handys nicht weggeworfen werden, nur weil das Display gebrochen ist oder der Akku schwächelt. Und eine Ausdehnung der Herstellergarantien wie auch Vorschriften, dass die Hersteller grundsätzlich bis zum Ende der Lebensdauer von Geräten Softwareupdates bereitstellen müssen, können den ungeheuerlichen Berg von weltweit knapp fünfzig Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr hoffentlich langsamer wachsen lassen.
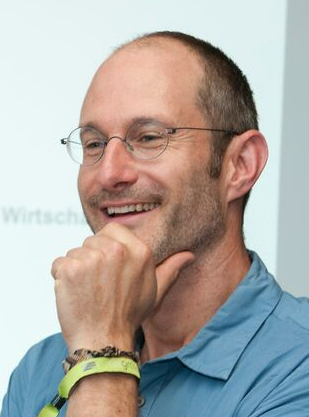
Eine sozial-ökologische Digitalpolitik wird die Effizienzpotentiale der Digitalisierung daher durch kluge Maßnahmen flankieren und sicherstellen, dass die Einsparpotentiale bei Energie und Ressourcen nicht durch Nachfragewachstum wieder aufgefressen werden. Um ein Beispiel zu bringen: Im Verkehrsbereich sollte der ÖPNV digital optimiert und das Sharing von Verkehrsträgern – Fahrrädern, Rollern, Mitfahrgelegenheiten – vereinfacht werden. Zugleich aber muss der motorisierte Individualverkehr durch aktive Politiken unattraktiver gemacht werden, etwa durch Parkraumverteuerung, Straßenberuhigung, Mautgebühren. Eine digital-ökologische Steuerreform kann ferner Rahmenbedingungen setzen, dass Strom- und Spritverbräuche kontinuierlich teurer werden, während gleichzeitig umweltfreundlichere Alternativen mit den Einnahmen entlastet werden.
Eine Besteuerung von Energie wie auch die genannte Verkürzung der Normalarbeitszeiten wird ferner wachstumsdämpfend wirken. Als hochentwickeltes Land können wir uns dies leisten! Wir sollten bei der Digitalisierung als derzeitiger Welle technologischer Innovationen dafür Sorge tragen, dass sich das ökonomische Hamsterrad nicht noch schneller dreht, sondern dass die Früchte der Digitalisierung den Menschen auch wieder mehr Zeit für Familie, Pflege, Sozialkontakte und Ehrenamt einräumen. Und zugleich zu einer moderaten Entschleunigung und zur Verminderung des hohen Stress- und Burn-Out-Levels unserer Leistungsgesellschaft beitragen.
Eine rasche Durch-Digitalisierung möglichst vieler Lebens- und Wirtschaftsbereiche und der Push für eine „Künstliche Intelligenz Made in Germany“ wird allein keine Nachhaltigkeit bringen. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Bundesregierung auf dem nächsten Digitalgipfel, aber auch im neu berufenen Digitalrat oder in künftigen Gesetzesvorlagen nicht nur darauf abzielt, mit Hilfe von Digitalisierung die Wirtschaft zum Brummen zu bringen. Es ist hohe Zeit, den wohlmeinenden Worten vom Gemeinwohl und der Nachhaltigkeit mit einer sozial-ökologischen Digitalpolitik Taten folgen zu lassen!





Ein wertvoller Beitrag mit vielen Impulsen für neue Ideen! Ich würde die Transformation auch noch erweitern, dahingehend, dass die Grundrechte in der durchdigitlalisierten Welt noch klarer verortet werden. Die DS-GVO ist hier sicherlich ein erster Schritt.
Und ein weitere Ansatzt. Die „Durchdigitalisierung“ kann auch nur wertsteigernd betrieben werden, wenn es Aufklärung gibt, welche Änderungen auf uns zu kommen. Von daher sollte diese Transformation auch z.B. in den Grundschulen gelehrt werden – und die Diskussion sollte um das Thema OpenSource, OpenData ergänzt werden.
Denn wir wollen doch am Ende, nicht nur freie KonsumentInnen sein, sondern freie BürgerInnen- nur so können wir die „Neo-Feudalherren und -frauen“ auf Augenhöhe begegnen und die neue Welt kritisch begleiten.
Tja, die Bundesregierung scheint ja jetzt schon ignorant zu sein gegenüber dem Neo-Feudalismus:
https://www.jungewelt.de/artikel/345414.armutsbericht-2018-politik-schafft-armenhaus.html