Es ist ein Zwischenschritt. Ob auch der entscheidende, wird sich demnächst im Bundesrat herausstellen: Die Fraktionsspitzen von Union, SPD, Grünen und FDP im Bundestag haben sich am Freitag auf eine Reform des Bildungsföderalismus geeinigt. Sie ist laut GroKo-Koalitionsvertrag Voraussetzung dafür, dass der rund 5,5 Milliarden Euro schwere Digitalpakt kommen kann. Mit dem Kompromiss gilt die Zweidrittelmehrheit zur geplanten Grundgesetzänderung als sicher. Allerdings nur im Bundestag. Ob das Programm tatsächlich wie versprochen Anfang 2019 starten kann, entscheidet sich an der ebenfalls nötigen Zweidrittelmehrheit in der Länderkammer. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekräftigte bereits, dass sein Land gegen die geplante Neufassung des Grundgesetz-Artikels 104c votieren werde.
Seit Freitag läuft zwischen Regierung und Opposition der Kampf um die Deutungshoheit. Was bedeutet der gefundene Wortlaut, und was bedeutet er nicht? Unstrittig ist, dass er all das ermöglicht, was die Bildungsminister von Bund und Ländern in den Entwurf ihrer Digitalpakt-Vereinbarung geschrieben haben, die sie am 6. Dezember paraphieren wollen. Aber was geht künftig darüber hinaus? Was ist das substantiell Neue gegenüber der bereits im Koalitionsvertrag versprochenen Grundgesetzänderung? Wie groß sind die Chancen, dass der Bundesrat zustimmt? Und ist der Digitalpakt so, wie er jetzt kommen kann, wirklich ein großer Wurf? Der Reihe nach.
Investitionen in Köpfe statt nur in „Beton“?
Die Große Koalition hatte im Artikel 104c nur ein Wort streichen wollen. Derzeit steht dort: „Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren.“ Das Wort „finanzschwachen“ sollte nach Wunsch von Union und SPD weg, so dass der Bund grundsätzlich allen Schulen unabhängig von der Finanzkraft der Kommunen hätte helfen können. Die Grundvoraussetzung, um ein flächendeckendes Investitionsprogramm wie den Digitalpakt umsetzen zu können.
Das „finanzschwachen“ fehlt dementsprechend auch im Kompromiss vom Freitag. Hinzu kommen aber eine Reihe weiterer signifikanter Veränderungen:
- Die Finanzhilfen sollen den Ländern „zur Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens“ gewährt werden. Teile der Union spielen die Bedeutung der neuen Formulierung herunter. Es sei doch klar, dass der Bund sein Geld immer zur Steigerung der Bildungsqualität einsetzen werde. Anders sieht das zum Beispiel die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding: „Damit ist der Weg eröffnet für bundesweit einheitliche Bildungsstandards“, sagte sie der FAZ. Es ist die weitestmögliche Interpretation der Neufassung.
Wie genau Investitionen im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur zu inhaltlichen Bildungsstandards beitragen sollen, sagen jedoch weder Suding noch andere Oppositionspolitiker. „Was konkret mit diesen Möglichkeiten gemacht wird, das ist offen, und das ist auch Teil der politischen Auseinandersetzung“, sagte FDP-Chef Christian Lindner der Nachrichtenagentur AFP. - Der Bund kann Finanzhilfen künftig nicht nur „für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen“, sondern auch für die „mit diesen verbundene besondere unmittelbare Kosten der Länder und Gemeinden“ zahlen. Grünen-Bildungsexperte Kai Gehring feiert die neue Möglichkeit, Bundesgeld „nicht nur in Beton, sondern auch in Köpfe“ stecken zu können, „und zwar verlässlich“. Das mit dem Beton ist ein etwas putziges Sprachbild, wenn man bedenkt, dass die erste Anwendung des neuen 104c der Digitalpakt sein soll. Putzig sind auch die „pädagogischen Köpfe“, die FDP-Chef Lindner als Profiteure nennt.
Abgesehen von solchen Wortklaubereien: Was genau bedeutet es, wenn FDP, Grüne und SPD von einer Bundesbeteiligung an den Personalkosten sprechen? SPD-Bildungspolitiker Karl Lauterbach macht es – bezogen auf den Digitalpakt – konkret: „Wir werden auch die Schulungen der Lehrer und die Bezahlung der Systemadministration unterstützen.“ Genau das ist es: Der Bund wird auch künftig keine Lehrerstellen zahlen können, er darf aber, wie die neue 104c-Formulierung betont, Kosten (mit-)finanzieren, die im direkten Zusammenhang mit seinen Investitionshilfen entstehen. Wenn dank des Digitalpaktes also neue Technik in die Schulen kommt, kann die Bundesregierung dabei helfen, dass die Lehrer den Umgang damit lernen und dass die Technik von Fachleuten am Laufen gehalten wird. - Die Bundeshilfen müssen nicht mehr von Jahr zu Jahr kleiner werden. Das steht so nicht im Wortlaut im geplanten 104c, aber sozusagen im Kleingedruckten. Denn der letzte (häufig überlesene) juristische Nachsatz des Grundgesetz-Artikels lautet künftig: „Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 bis 5 und Absatz 3 gilt entsprechend.“ Der bisherige Wortlaut: „Artikel 104b Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.“ Was im Umkehrschluss heißt, dass Artikel 104b Absatz 2 Satz 6 nicht mehr gilt für Investitionsprogramme nach 104c. Satz 6 lautet: „Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.“ Müssen sie jetzt also nicht mehr. Das ist das, was Kai Gehring meint, wenn er von „verlässlichen“ Bundeshilfen spricht.
Doch wie „verlässlich“ dürfen sie tatsächlich sein? Die Antwort: Eine Ewigkeitsgarantie, wie womöglich einige Enthusiasten erkennen wollen, ist die Neuformulierung nicht. Es geht weiter nur um Investitionen des Bundes und nicht um die Mitfinanzierung von Daueraufgaben. Investitionen und die dazugehörigen Programme sind notwendigerweise zeitlich begrenzt. Mit anderen Worten: Nach dem Grundgesetz könnte es künftig einen zweiten Digitalpakt geben, womöglich auch einen dritten. Aber keinen zehnten und keinen zwanzigsten. Diese Begrenzung wird sehr deutlich, wenn man den geplanten Artikel 104c für die Schulen vergleicht mit dem 2014 geänderten Artikel 91b für die Wissenschaft. Im ersteren ist von „Investitionen“ die Rede. Der 91b hingegen bestimmt, dass Bund und Länder „auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken“ können. Bei der Förderung zusammenwirken: Das ist unbegrenzt, inhaltlich wie zeitlich. Vorteilhaft ist die neue Formulierung des 104c trotzdem. Denn solange der Bund sich engagiert, kann er es in gleichbleibender Höhe tun und muss die Hilfen nicht mehr gegen Ende ausschleichen.
Wobei aus dem Vorteil auch ein Nachteil werden kann. Man stelle sich vor, die Länder verlassen sich darauf, dass der Bund künftig wesentliche Teile ihrer Fortbildungskosten (bei denen es um weit mehr geht als nur um ein paar „Schulungen“) und, siehe oben, der Systemadministration bezahlt. Und dann fällt das Programm weg. Von einem Jahr auf das andere wären die Länder auf sich zurückgeworfen, denn die Aufgaben bleiben ja. Insofern sollten sich die Landesregierungen genau überlegen, ob sie sich in dieser Form von einem Bundes-Investitionsprogramm abhängig machen sollten. Zumal etwas Zweites dazu kommt: Je mehr Bundesgeld die Länder in ihre laufenden Kosten stecken, desto weniger bleibt für die eigentlichen Investitionen. Es gibt Kultusministerien, die das verstanden haben und trotz der neuen Möglichkeiten planen, selbst die laufenden Kosten zu tragen. Sie werden gut daran tun.
Kann der Bundesrat den Kompromiss noch kippen?
Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann sagt: „Den Bildungsbereich besser auszustatten ist absolut notwendig. Aber der Weg ist falsch.“ Darum werde sein Land die geplante Grundgesetzänderung im Bundesrat ablehnen. Neu ist das nicht. Kretschmann und seine Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) haben ihr Nein seit Monaten angekündigt. Sie fordern eine andere Verteilung der Steuerlast zwischen Bund und Ländern, damit den Ländern mehr Geld für die Bildung bleibt.
Bis zur Abstimmung im Bundesrat, die noch im Dezember (voraussichtlich am 14.) folgen wird, dürfte Kretschmann unermüdlich daran arbeiten, weitere Länder ins Nein-Lager hinüberzuziehen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gilt diesbezüglich als heißer Kandidat, allerdings scheint sich beispielsweise seine FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer über die Einigung zu freuen. „Die Schulen vor Ort setzen darauf, dass nun das Geld des Digitalpakts zu Beginn des neuen Jahres bei ihnen ankommt“, sagte sie am Freitag. Dass NRW mit Baden-Württemberg stimmt, ist also unwahrscheinlich. Und selbst im Falle einer Enthaltung des größten Bundeslandes würden dem Ja-Lager gerade mal 12 von 69 Stimmen fehlen. Sie brauchen aber nur 46 für die Zweidrittelmehrheit. Stand heute ist ein Ja des Bundesrates also wahrscheinlicher als eine Ablehnung.
Ende gut, Digitalpakt gut?
Anja Karliczek (CDU) hatte Grüne und FDP in den Tagen vor der Einigung vor einem Scheitern der Grundgesetz-Verhandlungen gewarnt. „Mit der Diskussion um den #Bildungsföderalismus nehmen sie billigend in Kauf, dass moderne Bildung in Form des Digitalpaktes nicht in die Umsetzung gehen kann“, twitterte die Bundesbildungsministern am vergangenen Dienstag. Am Freitagnachmittag sagte sie dann, dies sei „ein guter Tag für Schüler, Eltern und Lehrer in Deutschland.“ SPD-Chefin Andreas Nahles meinte nach der Einigung: „Endlich können jetzt alle Schulen überall in Deutschland eine gute digitale Ausstattung bekommen – schnelles Internet, Tablets, Schulungen des Personals.“ Tatsächlich durfte die Erwähnung von Tablets, Laptops oder anderen Endgeräten, die der Bund den Schulen künftig spendieren darf, in kaum einer Politikeräußerung fehlen.
Was am Freitag keiner sagte: Der Passus, dass der Digitalpakt auch Endgeräte fördern darf, wenn auch nur solche, die in den Schulen verbleiben, ist erst ziemlich spät in die Vereinbarung gerutscht. Noch im Frühjahr antwortete der BMBF-Staatssekretär Thomas Rachel auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, die Länder würden keine Tablets und Laptops mit Bundesgeld kaufen können.
Tatsächlich hatten Bildungsexperten aus gutem Grunde und am Ende vergeblich versucht, die Regelung draußen zu halten. Denn wenn die Schulen jetzt 20 Prozent der Paktmittel (das entspricht den neulich zitierten bis zu 25.000 Euro pro Schule) für technisch schnell veraltete Endgeräte ausgeben können, fehlt ihnen das Geld an anderer – wichtigerer – Stelle.
So hatte zum Beispiel der Bremer Informatikexperte Andreas Breiter im Februar 2018 in einem Interview gewarnt, er hielte es „aus Nachhaltigkeitsgründen für einen gravierenden Fehler, wenn die Länder mit dem Paktgeld Endgeräte kaufen“. Und Breiter fügte hinzu: „Dringendste Aufgabe muss sein, die digitale Infrastruktur endlich auf ein Niveau zu heben, mit dem die Schulen überhaupt mal vernünftig arbeiten können – ein Niveau, das für jeden Mittelständler und fast jeden Privathaushalt mittlerweile selbstverständlich ist.“
Zwar enthält der jüngste Pakt-Entwurf offenbar die Bedingung, dass zunächst die entsprechende Infrastruktur geschaffen worden sein muss, bevor Geld in Endgeräte fließen darf. Aber die Definition dessen, was eine angemessene Infrastruktur darstellt, ist dehnbar – erst recht, wenn gleichzeitig die Anschaffung von Laptops & Co. lockt.
Endgeräte für den Show-Effekt
Die Logik der Politik ist ohnehin mitunter eine andere und eine ganz einfache: Die digitale Infrastruktur sieht man nicht. Die Tablets und Laptops in den Händen der Schüler schon, sie machen sich gut in der Presse. Und so tut man den Chef-Unterhändlern des Digitalpakts kein Unrecht, wenn man ihnen an dieser Stelle auch das Hoffen auf die politischen Show-Effekte unterstellt.
Dabei hätte es einen anderen Weg gegeben, auch ihn haben Bildungsexperten verschiedentlich aufgezeigt. Die Länder hätten den Eltern die Anschaffung von Endgeräten als grundlegend für den Unterricht vorgeben können – so wie sie es mit Schulbüchern auch tun. Verständlich, dass das Länder mit Lernmittelfreiheit aus Kostengründen vermeiden wollten, aber hier hätte man zumindest Zuzahlungen der Eltern verlangen können. Wahrscheinlich müssen die Kultusministerien diesen unpopulären Schritt trotzdem irgendwann gehen, denn 25.000 Euro pro Schule reichen ohnehin nicht für alle, zumindest wenn man digitale Geräte nicht ab und an mal, sondern grundsätzlich im Unterricht einsetzen möchte.
Das Stichwort wird also zwangsläufig lauten: „Bring your own device“ (BYOD). Und die Digitalpakt-Endgeräte werden vor allem von jenen Schülern genutzt werden, deren Eltern keines finanzieren können. Das ist teuer, stigmatisierend und unnötig. Teuer, weil wie gesagt im Digitalpakt eine Milliarde für andere Investitionen fehlen wird. Stigmatisierend, weil die übrigen Schüler dann genau erkennen können, wer solvent genug ist und wer nicht. Und unnötig, weil so Gelder aus dem Digitalpakt nicht für Bildungs-, sondern für Sozialpolitik eingesetzt werden. Bund und Länder sind verpflichtet, gleiche Bildungschancen für alle unabhängig von der Herkunft zu schaffen, doch zu diesem Zweck gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket, finanziert aus dem Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Für die Familien, die sich „BYOD“ nicht leisten können, könnte und sollte das Teilhabepaket aufgestockt werden, und zwar auf Dauer. Das sollte in einer digitalisierten Gesellschaft eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und den Digitalpakt hätte die Aufstockung entscheidend entlastet.
Aber offenbar haben die Bildungsminister aus Bund und Ländern die schwierigen Verhandlungen mit dem Ministerium von Hubertus Heil und (natürlich) dem Finanzministerium von Olaf Scholz gescheut. Andererseits sind beide SPD-Politiker, und da hätte man sie durchaus packen können. Hat man aber nicht.
Es ist die wohl gravierendste Schwäche des neuen Bund-Länder-Programms, das ansonsten zu Recht gelobt wird. Doch wird darüber wohl in nächster Zeit kaum einer reden. Bund und Länder sind zu erleichtert, dass sie – vorausgesetzt das Ja des Bundesrates – überhaupt noch den Abschluss hinbekommen haben. Und die Schlagzeile, dass (inklusive dem 10-Prozent-Länderanteil) endlich 5,5 Milliarden für Digitalisierung fließen, wird die inhaltliche Debatte überstrahlen. Zumindest eine Zeitlang.
—
Jan-Martin Wiarda ist Journalist, Politikwissenschaftler und Volkswirt. Er ist Autor für die Süddeutsche Zeitung, Brand Eins, die Financial Times Deutschland und den Tagesspiegel, war acht Jahre Redakteur im Bildungsressort der Zeit und ist seit 2015 freischaffend. Der Text ist zuerst auf seinem Blog jmwiarda.de erschienen.



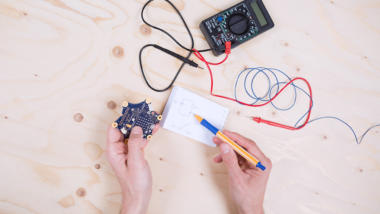

Tablets anstatt Schulbücher!
Wenn ich sehe wie ein kleines Kind den schweren Tonni jeden Tag schleppen muss… da erinnere ich mich an die Zeit wo ich mir als Kind damit den Rücken krank gemacht habe…
=.-(
Schon mal versucht, Kinder zu unterrichten (also z.B. sie dazu zu bringen, Dir zuzuhören, wenn Du eine Ansage machst), die vor ihren privaten Geräten sitzen, auf denen Dinge installiert sind, die Dich als Lehrer/in ja nix angehen?
Praktiker sagen: Kein Problem, alle Vorurteile sind schnell wiederlegt.
https://www.deutschlandfunk.de/digitalisierung-mit-tablet-statt-stift-und-papier-in-die.724.de.html?dram:article_id=426568