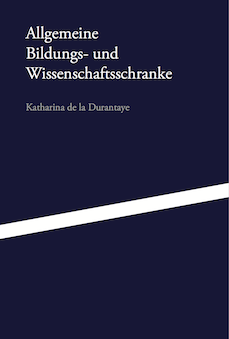 Ein gutes Jahre lang hat sich Katharina de la Durantaye, Juniorprofessorin für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) eingehend mit der Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht beschäftigt. Das 340 Seiten starke Ergebnis liegt nun vor und ist erfreulicherweise auch im Volltext zugänglich (PDF).
Ein gutes Jahre lang hat sich Katharina de la Durantaye, Juniorprofessorin für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) eingehend mit der Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht beschäftigt. Das 340 Seiten starke Ergebnis liegt nun vor und ist erfreulicherweise auch im Volltext zugänglich (PDF).
Ausgangspunkt für Durantayes Analyse ist eine harte Beurteilung der bestehenden Rechtslage:
„Die für Bildung und Wissenschaft relevanten urheberrechtlichen Schranken erfassen in der Regel nur eng umrissene Sachverhalte, sind wenig technologieoffen und nicht allgemein verständlich formuliert. Zudem sind sie über mehrere Einzelnormen hinweg verstreut. Das führt zu großer Rechtsunsicherheit für Forscher, Wissenschaftler und Lehrer, aber auch für Infrastruktureinrichtungen wie Bibliotheken, Archive und Museen.“ (S. 1)
In ihrer Arbeit spricht sich Durantaye an Stelle der zersplitterten und auf verschiedene Paragraphen verteilten Regelungen zum Thema Bildung und Wissenschaft im Urheberrecht für eine „generalklauselartige Schrankenregelung für Bildungs- und Wissenschaftszwecke“ (S. 2) aus, „die durch Regelbeispiele konkretisiert wird“ (S. 4) . Unter anderem zeigt Durantaye in ihrer Arbeit, dass eine solche generalklauselartige Schranke auch unter den gegebenen völker- und europarechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland umgesetzt werden könnte und verweist diesbezüglich auf britische Regelungen als Vorbild.
Durantaye liefert außerdem gleich einen konkreten Formulierungsvorschlag für die neue Schranke mit:
„Zulässig ist die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung eines veröffentlichten Werkes zur Veranschaulichung des Unterrichts an Bildungseinrichtungen oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, wenn und soweit die Nutzung in ihrem Umfang durch den jeweiligen Zweck geboten ist und keinen kommerziellen Zwecken dient.“ (S. 214)
Diese allgemeine Schranke sollte dann noch um Regelungsbeispiele wie „durch den Unterrichtenden zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts“ oder „zur eigenen Unterrichtung über den Stand der wissenschaftlichen Forschung“ (ebd.) exemplarisch konkretisiert aber bewusst offen gehalten werden.
Urheberrechtliches Gruselkabinett
Warum so eine neue, allgemeine Schrankenregelung sinnvoll und notwendig ist, wird vor allem in jenen Teilen des Bands deutlich, die sich mit den bestehenden Schranken auseinandersetzen. Die bestehenden Regelungen lesen sich teilweise wie ein urheberrechtliches Gruselkabinett. Besondere „Schmankerl“ sind Bestimmungen wie jene in § 53 Abs. 2, der die Vervielfältigung eines eigenen Werkes zur Aufnahme in ein eigenes Archiv „nur auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung“ (S. 85) erlaubt. Auch dürfen Universitätsbibliotheken nach § 53a UrhG Einzelbestellungen von Artikeln nicht als PDF mailen sondern nur „im Wege des Post- oder Faxversands“ übermitteln. „Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ausschließlich als grafische Datei […] zulässig“, sodas die Datei „nur zum Lesen des Inhalts genutzt werden kann.“ (S. 100; hoffentlich erzählt niemand dem BGH von OCR-Software). Selbstverständlich muss die übermittelnde Bibliothek aber auch bei einer Übermittlung via Faxgerät eine Vergütung entrichten.
An der allgegenwärtigen Vergütungspflicht möchte Durantaye auch bei einer Neugestaltung festhalten. Nahezu alle durch die neue Schrankenregelung vorgeschlagenen Nutzungen sollen nach dem Regelungsvorschlag (S. 214) vergütungspflichtig sein, um die Interessen der Rechteinhaber nicht über Gebühr zu belasten. Ob das aber im Wissenschaftsbereich genauso angemessen ist wie im Bereich des bloßen Konsums (z.B. Pauschalvergütung für Privatkopie-Schranke) scheint zweifelhaft. Denn die Nutzung für Bildung und Forschung ist klar im öffentlichen Interesse bzw. profitiert letztlich die Allgemeinheit; auch im Vergleichsfall Großbritannien ist eine gesetzliche Vergütungspflicht keineswegs die Regel (vgl. z.B. S. 159f.).
Mit ein Grund für den Vorschlag der Vergütungspflicht ist wohl die etwas zu unkritische Einschätzung der Rolle von Fachverlagen (z.B. S. 13ff.) für wissenschaftliches Publizieren vor allem im Bereich von Fachzeitschriften. So erzeugen Formulierungen wie „Fachzeitschriftenverlage unterhalten Zeitschriftenredaktionen“ den Eindruck, als würde die Erstellung von Inhalten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften von Verlagen finanziert. Das ist aber nicht der Fall. In der Regel wird weder für die Texte noch für die Begutachtung noch für die Herausgeberschaft etwas bezahlt. Auch dass Bibliotheken sich „an ‚Produktivitätsfortschritten‘ finanziell beteiligen“ (S. 14) sollen, wie aus einer Stellungnahme des Börsenvereins des deutschen Buchhandels zitiert wird, ist grotesk: „Produktivitätsfortschritte“ sollten wohl eher zu sinkenden Kosten führen und nicht zu Mehrkosten für Bibliotheken, wie sie erst kürzlich wieder bei der Auseinandersetzung zwischen der Universität Konstanz und Elsevier Thema waren. Gleichzeitig wird neuen Open-Access-Zeitschriften pauschal attestiert, „bislang (noch) nicht […] über einen den etablierten Zeitschriften entsprechenden impact factor [zu] verfügen“ – was zumindest im Bereich der Naturwissenschaften mit Zeitschriften wie PLoS Biology (Nummer 1 im Bereich „Biology“) oder PLos Genetics nicht zutrifft. Solche Detailunschärfen sind aber wohl der großen Breite des Themas geschuldet, die in der Abhandlung sehr gut deutlich wird.
Fazit
Wer sich durch Durantayes detaillierte Schilderung der geltenden Rechtslage im deutschen Wissenschaftsurheberrecht gekämpft hat und immer noch am diesbezüglichen Handlungsbedarf zweifelt, dem ist nicht mehr zu helfen. Im Unterschied zu anderen urheberrechtlichen Baustellen wie beispielsweise dem fehlenden Recht auf Remix, lässt sich im Bereich Bildung und Wissenschaft aber auf nationaler Ebene auch ein größerer Wurf umsetzen. Der neue Justizminister Heiko Maas wird sich auch daran messen lassen müssen, ob er einen entsprechenden Versuch unternimmt. Katharina de la Durantaye serviert ihm mit ihrer Analyse entsprechende Formulierungsvorschläge auf dem Silbertablett. Maas müsste eigentlich nur noch zugreifen.
Terminhinweis: am Freitag, den 9. Mai 2014, findet von 10 bis 18 Uhr im Auditorium des Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin eine Tagung statt, die sich mit den Inhalten der Studie auseinandersetzt.




Prima, dass es diese rasche, kritische, aber doch konstruktive Stellungnahme gibt. Ob allerdings der Justizminister Heiko Maas nur noch auf die Formulierungsvorschläge von Durantaye zugreifen muss, muss bezweifelt werden. Eine wirklich praktikable Wissenschaftsschranke/-klausel müsste viel viel einfacher und umfassender sein; sonst kommen wir aus dem von Durantaye trefflich beschriebenen „Gruselkabinett“ des Urheberrechts für Bildung und Wissenschaft nicht heraus. Die Analyse ist weitgehend einsichtig, die Konsequenzen bleiben – aber das müssen Juristen wohl – im Rahmen der vermeintlich unüberwindbaren Hürden der vor allem europarechtlichen Vorgaben (obgleich diese ganz offensichtlich auf der Agenda der Überprüfung stehen). Mal sehen, was der 5. Mai auf der Tagung an Einsichten erbringt.
Sorry, ist natürlich der 9.5.2014
Ja, so euphorisch wie Herr Dobusch bin ich nicht.
Im Bereich der Kopienlieferungen für die Wissenschaft bleibt einiges unklar. Okay, die kleinen Teile eines Werkes sind weg, und die Rastergrafiken.
Vom Rest bin ich massiv enttäuscht. Statt eines klaren Schrankenrechts im Stile eines „fair use“ werden weiter Erbsen gezählt und unklare Ausnahmen weit ausgebreitet. Es hält ein neuer unscharfer Begriff der „Gebotenheit“ an vielen einzelnen Nachsätzen Einzug, was mir schwächer erscheint als eine Fair-Use-Regelung. Auch das ist wiederum nur einem Gericht letztlich möglich, ordentlich zu bewerten, in der Praxis bleibt es bei der Rechtsunsicherheit.
Warum die Autorin sich an so unscharfen Begriffen orientiert, wie „soweit und wenn geboten“ oder „nichtkommerzielle Zwecken“ ist mir rätselhaft. Woher soll jemand wissen, wann etwas „geboten“ ist und wann nicht- ohne Rechtsabteilung? Da ist wohl auch entgangen, dass sich viele öffentliche Bibliotheken heute sehr stark aus Gebühren finanzieren und keineswegs mehr einfach so als „nichtkommerziell“ gelten können wie zu Opas Zeiten. Also wird es weiter Klagen geben, allein aus dem Bedürfnis heraus, die Grenzen des Gesetzes genauer ausloten zu wollen.
Auch die „elektronische Terminals“ bleiben in der eigenen Einrichtung. Und damit alles beim alten.
Dabei wäre es so einfach:
„Zum Zwecke von Wissenschaft und Forschung sowie zur Veranschaulichung im Unterricht und zur Gestaltung und Vertiefung des Lehrstoffs ist es zulässig, Werke aufzuführen, zu vervielfältigen, zugänglich zu machen und zu übermitteln, solange keine anderen gewichtigeren Gründe dagegen stehen. Für die Werknutzung wird eine angemessene Entschädigungspauschale erhoben, die nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden kann. Die weitere Ausgestaltung dieser Schranke wird in einschlägigen Verordnungen und Erlässen der Länder geregelt.“