Dr. Steffen Lange ist Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Seine Themenschwerpunkte sind Digitalisierung, nachhaltiges Wirtschaften, Ökologie und Wirtschaftswachstum.
Prof. Dr. Tilman Santarius lehrt an der Technischen Universität Berlin und am Einstein Centre Digital Futures und ist Teil der Forschungsgruppe „Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation“ am IÖW. Seine Schwerpunktthemen sind Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, Postwachstum und digitale Transformation.
Prof. Dr. Angelika Zahrnt ist Ehrenvorsitzende beim BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. Sie arbeitet und publiziert zu den Themen Nachhaltigkeit, Postwachstumsgesellschaft und Suffizienz und ist Beraterin in verschiedenen Gremien.
Digitale Geräte und Anwendungen eröffnen unzählige neue Möglichkeiten. Aber wie steht es um die Folgen für Umwelt und Gerechtigkeit? Zum Thema ökologische Nachhaltigkeit haben vor allem drei Aspekte der Digitalisierung weitreichende Auswirkungen auf den Energie- und Ressourcenverbrauch.
Erstens geht der Aufbau digitaler Geräte und Infrastrukturen zunächst mit einem erheblichen Energie- und Ressourcenverbrauch einher – für die Endgeräte, aber auch die Router, Server, Rechenzentren, Übertragungsnetzwerke, Unterseekabel und so weiter. Hinzu kommt der Energieverbrauch in der Nutzungsphase, der bereits 10 Prozent der weltweiten Stromnachfrage ausmacht.1
Zweitens wirkt Digitalisierung als Effizienzmaschine. Doch zu einem merklichen Rückgang von Energie- und Resourcenverbräuchen hat die Digitalisierung der letzten Jahrzehnte aufgrund von Reboundeffekten nicht beigetragen.
Und drittens wird erkennbar, dass Digitalisierung neue Chancen für eine Transformation von Konsum- und Produktionsweisen in Richtung Nachhaltigkeit bietet. Wie viel zusätzliche Digitalisierung können wir uns auf dem begrenzten Planeten Erde also noch leisten?
Genau an dieser Frage setzt die Idee der Digitalen Suffizienz an. Wie Suffizienz zu mehr Nachhaltigkeit führt und wie das spezifische Prinzip der digitalen Suffizienz ausbuchstabiert werden kann, zeigen wir im Folgenden.
Suffizienz – Die Bedeutung des Begriffs in der Nachhaltigkeitsdiskussion
Der Begriff „Suffizienz“ kommt vom Lateinischen „sufficere“, was so viel wie „ausreichen“ bedeutet. Es geht bei der Suffizienz um die Frage nach dem rechten Maß und „das Gute Leben“, individuell und in globaler Verantwortung.2
Bisher galt Suffizienz als individuelle Aufgabe und allein als persönliche Wertentscheidung. So wichtig die Ansätze Einzelner sind, individuelles Handeln ist immer in institutionelle und gesellschaftliche Kontexte eingebunden. Suffizienzpolitik will diese so gestalten, dass es einfacher wird, nachhaltige Lebensstile zu praktizieren.
In der Nachhaltigkeitsdebatte wurde schon in den 1980er-Jahren die Bedeutung der drei Prinzipien Effizienz, Suffizienz, Konsistenz herausgearbeitet.
Das technikkonzentrierte Prinzip der Effizienz etablierte sich schnell zum zentralen und politisch allseits anerkannten Instrument der Einsparung von Energie und Ressourcen. Damit war die Hoffnung verbunden, den „Way of Life“ beibehalten zu können, denn durch neue „grüne“ Technologien sollten Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum entstehen.
Ende der 1990er-Jahre wurde deutlich, dass die Effizienzstrategie nicht ausreicht, um die für eine nachhaltige Entwicklung nötigen Einsparziele zu erreichen, insbesondere wegen des Reboundeffekts. Der Gedanke der Suffizienz kam stärker in die öffentliche Debatte.
Inzwischen ist die Einsicht gewachsen, dass Suffizienz notwendig ist – nicht nur durch ein geändertes individuelles Verhalten, sondern auch durch andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Digitale Suffizienz – das richtige Maß finden
Wie lässt sich nun der allgemeine Gedanke der Suffizienz in den Bereich der Digitalisierung übertragen? Das Prinzip der digitalen Suffizienz wird von dem Motto geleitet: „So viel Digitalisierung wie nötig, so wenig wie möglich“.
Es soll dazu dienen, die nicht nachhaltigen Auswüchse einer ressourcenintensiven Digitalisierung (zu)vieler Lebens- und Wirtschaftsbereiche einzudämmen, möglichen Reboundeffekten von digitalen Effizienzsteigerungen entgegenzuwirken und stattdessen die positiven ökologischen Potenziale der Digitalisierung zu aktivieren.
Insofern geht es - wie bei Suffizienz im Allgemeinen - nicht um einen aufopfernden „Verzicht“ oder eine Einschränkung um jeden Preis, sondern um das rechte Maß, zum Beispiel um eine sinnvolle Anzahl digitaler Geräte in Haushalten, Unternehmen und öffentlicher Infrastruktur.
Das Ziel ist, dass digitale Suffizienz insgesamt zu einer deutlichen Reduktion der globalen Ressourcen- und Energieverbräuche und einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Das Prinzip der digitalen Suffizienz wurde erstmals im Buch „Smarte grüne Welt“3 definiert und mit den folgenden drei Prinzipien inhaltlich gefüllt: Technik-, Daten- und Nutzungssuffizienz.
Wir haben „ökonomische Suffizienz“ als viertes Prinzip hinzugefügt.
(1) Techniksuffizienz zielt darauf ab, Informations- und Kommunikationssysteme so zu konzipieren, dass nur wenige Geräte nötig sind und diese selten erneuert werden müssen. Zunächst bedeutet Techniksuffizienz, sich um eine sozial und ökologisch nachhaltige Herstellung aller Geräte und Infrastrukturkomponenten (zum Beispiel Rechenzentren) zu bemühen.
Sogenannte Konfliktrohstoffe, deren Einsatz mit sozialen und ökologischen Problemen verbunden ist, müssen systematisch aus der Produktion verbannt werden. Ökologisch besonders umstrittene Stoffe und Produktionsverfahren müssen nach Möglichkeit substituiert werden. Ferner ist es wichtig, sowohl bei Hard- als auch bei Softwareentwicklung auf eine lange Nutzungsdauer zu achten, ebenso wie auf Reparierbarkeit und modulare Erweiterbarkeit von Geräten.
Geplante Obsoleszenz darf es nicht geben. Auch Software muss „reparierbar“ und langfristig nutzbar sein, wie es die Open-Source-Software bereits vormacht.
(2) Datensuffizienz bezieht sich auf das Design digitaler Anwendungen. Mehr Datenverkehr erfordert mehr Serverkapazitäten und IT-Infrastruktur – und im Allgemeinen auch mehr Stromverbrauch. Software wird über die Jahre oft so weiterentwickelt, dass sie zunehmenden Datenverkehr hervorruft.
Datensuffizienz bringt auch die zentrale Frage in die öffentliche Debatte: Wie viel permanente Vernetzung und Datenverkehr ist wirklich nötig, um bestimmte gesellschaftliche und ökologische Ziele zu erreichen? Jede Diskussion über Smart City, Smart Home, Smart Mobility oder das Internet der Dinge sollte stets mit dieser kritischen Frage beginnen.
(3) Nutzungssuffizienz trägt der Tatsache Rechnung, dass Nachhaltigkeitsziele nicht durch smarte Technologien allein erreicht werden können. Auch ein Umdenken und veränderte Verhaltensmuster der Nutzer*innen sind gefragt. Wenn das Smartphone kaputtgeht, können Nutzer*innen versuchen, es zu reparieren, anstatt sich sofort ein neues Gerät zu kaufen – sofern ein techniksuffizientes Design der Geräte dies zulässt.
Wenn im Internet Kleidung, technische Geräte oder Möbel auch gebraucht statt neu gekauft werden, bedarf es dafür dennoch der individuellen Bereitschaft. Und auch wenn smarte Netze ein dezentrales Energiesystem technisch möglich machen, so fußt die Energiewende doch auf lokalen Initiativen und engagierten Menschen, die vor Ort daran mitarbeiten.
Nutzungssuffizienz zielt vor allem darauf ab, dass digitale Tools nicht zu Reboundeffekten führen: Wenn die intelligente Vernetzung des Verkehrs dazu führt, dass man schneller und kostengünstiger von A nach B kommt, legen suffizienz orientierte Nutzer*innen trotz dieser Möglichkeit in Summe dennoch nicht mehr Kilometer zurück.
Und wenn dank digitaler Kommunikation Aktivitäten und Logistik schneller bewältigt werden können, werden suffiziente Nutzer*innen dies nicht für zusätzliche Aktivitäten nutzen, sondern Zeitwohlstand genießen. Letztlich muss sich jede Nutzerin und jeder Nutzer fragen: Wie viele digitale Geräte und wie viel permanente Vernetzung benötige ich – sowohl beruflich wie privat, um ein zufriedenes Leben führen zu können?
(4) Ökonomische Suffizienz schließlich zielt auf die Systemebene ab. Die zentrale Frage lautet dabei: Wie kann die Digitalisierung genutzt werden, um eine Wirtschaft ohne Wachstum entstehen zu lassen, deren Naturverbrauch radikal sinken kann und in der eine gute Lebensqualität der Menschen möglich wird?
Eine Schlüsselrolle kommt hierbei der Reregionalisierung zu. Bislang galt die Kritik, eine schrittweise Dezentralisierung (und Deglobalisierung) kontinentaler und transnationaler Warenströme sei zu ineffizient oder bei komplexen industriellen Produkten technisch nicht machbar.
Mithilfe der Digitalisierung lassen sich die Grenzen dessen verschieben, was lokal wirtschaftlich und machbar ist: So können zum Beispiel Praktiken des Sharing, des Prosuming, des Doityourself gefördert werden. In der Landwirtschaft können kleinbäuerliche Betriebe über kommunale oder regionale Plattformen ihre Ernten an lokale Märkte oder direkt an Endkund*innen verkaufen.
Mit intelligent gesteuerten und vernetzten „Micro Grids“ lässt sich ein dezentrales Energiesystem aufbauen, bei dem Windkrafträder, Solaranlagen und so weiter im Besitz vieler tausend Privatpersonen, Genossenschaften oder Kommunen liegen anstatt in der Hand weniger großer Energiekonzerne. Auch die Produktion industrieller Güter kann aufgrund zunehmend automatisierter Produktionsverfahren in die Region zurückgeholt werden – wie es im Übrigen bereits etliche Konzerne vormachen.
Am Übergang in die Postwachstumsgesellschaft
Die Digitalisierung läuft derzeit in die falsche Richtung des „weiter, schneller, mehr“ mit den damit verbundenen ökologischen Problemen. Doch digitale Technologien bergen das Potenzial, eine neue Wirtschaft zu entwickeln, die wachstumsunabhängig sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeit verfolgt.
Dafür müssten digitale Technologien technik- und datensuffizient konzipiert und für Nutzungs- und ökonomische Suffizienz angewendet werden. So könnte sie dabei helfen, viele der bisherigen Probleme dezentraler Wirtschaftskonzepte zu überwinden, indem digitale Technologien helfen können, einen „kosmopolitischen Lokalismus“ zu verwirklichen, der nicht auf Abschottung, sondern auf gerechten globalen Handel setzt.
Am Ziel der Nachhaltigkeit und dem Prinzip der Suffizienz orientiert, könnte die Digitalisierung so zum Übergang in die Postwachstumsgesellschaft beitragen. Das Prinzip der digitalen Suffizienz kann eine Orientierungshilfe für eine solche Neuausrichtung geben. Es hängt an den Entwickler*innen, den Nutzer*innen und nicht zuletzt der Politik, die Digitalisierung in diese neue Richtung zu steuern.
Die Konferenz „Bits & Bäume“ brachte im Jahr 2018 erstmals im großen Stil Aktive aus der Zivilgesellschaft zusammen, um die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Jetzt ist das Konferenzbuch „Was Bits und Bäume verbindet“ erschienen. Als Medienpartner der Konferenz veröffentlichen wir an dieser Stelle jeden Montag einen Beitrag daraus. Das ganze Buch ist auch als Download verfügbar und steht unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 DE.
Fußnoten
- Andrae, A., & Edler, T. On Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030. Challenges 6, Nr. 1: 117–157 (2015)
- Schneidewind, U., & Zahrnt, A. Damit gutes Leben einfacher wird, Perspektiven einer Suffizienzpolitik. München: oekom Verlag (2018)
- Lange, S., & Santarius, T. Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit. München: oekom Verlag. (2018)



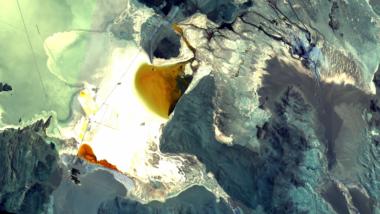

0 Ergänzungen
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr, daher sind die Ergänzungen geschlossen.