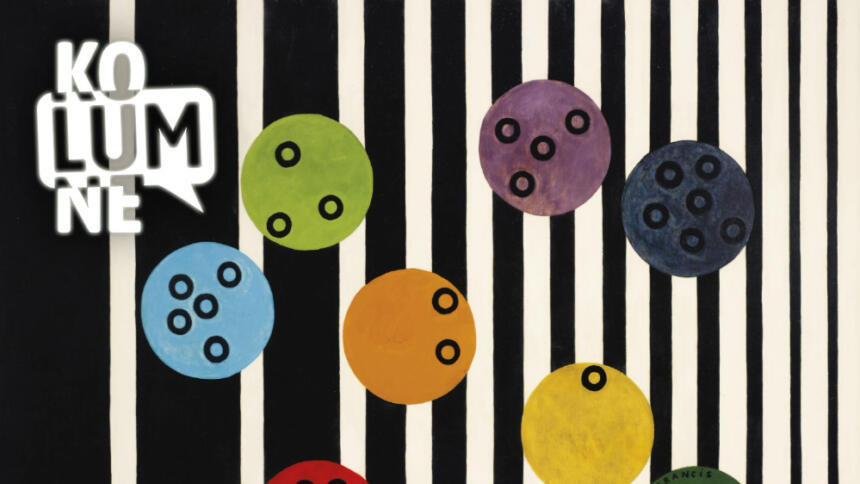„Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann“ – dieser bekannte Aphorismus stammt vom französischen Künstler Francis Picabia, der in seiner Malerei mehrfach die (Stil-)Richtung wechselte: vom Impressionismus zum Kubismus, vom Surrealismus zum Dadaismus, von Fotorealismus zu Abstraktion. Er kopierte Motive und ahmte Malweisen anderer Maler nach, um daraus neue Werke zu schaffen. Damit beeinflusste er die moderne Kunst mit Kunstrichtungen wie Pop Art und Konzeptkunst maßgeblich.
Picabia starb am 30. November 1953 und gehört damit zu den Künstler*innen, deren Werke zum 1. Januar 2024 gemeinfrei wurden. An jedem ersten Januar feiern wir den Public Domain Day – den Tag also, an dem regelmäßig der urheberrechtliche Schutz von Werken endet und sie in die Gemeinfreiheit übergehen. Damit können sie von allen zu jedem beliebigen Zweck verwendet werden, ohne dass dafür erst Genehmigungen eingeholt oder Nutzungsrechte bezahlt werden müssen. In Europa gilt dies für alle Werke, deren Urheber*innen siebzig Jahre zuvor verstorben sind.
Auch in diesem Jahr versammelt der Public Domain Day wieder eine eindrucksvolle Liste von Personen aus Kunst, Literatur und Wissenschaft. Der Aktionstag würdigt ihre Kreativität und stellt zugleich heraus, dass ihre Werke auf den Arbeiten anderer aufbauen. Denn wie auch Francis Picabias Gesamtwerk zeigt, beruhen kulturelles und künstlerisches Schaffen auf dem Neu-Kombinieren und Weiterentwickeln von bereits Bestehendem – Everything is a Remix. Die Werke schöpfen aus dem Gemeingut und werden folgerichtig nach Ablauf des urheberrechtlichen Schutzes gemeinfrei. Dabei sind die Schutzfristen, die das Urheberrecht gewährt, Ausnahmen auf Zeit und deutlich zu lang.
Gebt endlich die Bilder frei!
Immerhin ist mit der EU-Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt erstmals und unter maßgeblichem Druck aus der Zivilgesellschaft ein Gesetz erstritten worden, in dem die Public Domain ausdrücklich erwähnt ist. Artikel 14 regelt, dass die digitalen Abbilder gemeinfreier Werke der bildenden Kunst ebenso wie die Werke selbst urheberrechtsfrei sind. Seit 2021 ist dieser Paragraph auch im deutschen Urheberrecht verankert.
Zuvor war das gemeinfreie Kulturerbe im Netz nicht automatisch gemeinfrei und für die Allgemeinheit frei nutzbar. Vielmehr war es rechtlich möglich, den gemeinfreien Status des eigentlichen Werks durch neue Schutzrechte für die digitale Reproduktion zu unterlaufen. Bis vor den Bundesgerichtshof wurde zwischen Wikimedia Deutschland und den Reiss-Engelhorn-Museen darüber gestritten, ob die handwerklich einwandfreie Reproduktion eines Kunstwerks selbst eine künstlerische Leistung ist und damit Lichtbildrechte geltend gemacht werden können.
Doch auch aus der Museumswelt selbst war der Ruf zu vernehmen: „Gebt endlich die Bilder frei!“ Diesen Beitrag begann Roland Nachtigäller – damaliger Direktor im Museum Marta Herford – mit der Frage, warum man eigentlich nicht jedes Lieblingskunstwerk ungehindert fotografieren und auf Social Media teilen darf.
Trotz der Novellierung des Urheberrechts besteht bis heute beim Fotografieren gemeinfreier Werke eine rechtliche Unsicherheit. Denn Fotoverbote können in Museen auch auf andere Weise begründet werden, etwa aus konservatorischen Erwägungen oder zur Aufrechterhaltung des geregelten Betriebes. Ob das Hausrecht und die beim Ticketkauf eingegangenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen hier höherrangig sein können als die im Urheberrecht geregelte Gemeinfreiheit, ist rechtlich bislang ungeklärt.
Möglichst viele Kultur- und Gedächtnisinstitutionen sollten dem Beispiel Hessens folgen. Die dort erarbeitete Open Access Policy für Kulturerbe-Einrichtungen orientiert sich am Grundsatz „So offen wie möglich“ und formuliert für alle Häuser den Anspruch, geltende Hausregeln zu überprüfen und Fotoverbote nur dann aufrechtzuerhalten, wenn sie unumgänglich sind.
Doch das ist nur ein Aspekt im Prozess, das eigene Haus zu öffnen. Wichtig ist eine umfassende Strategie, durch Digitalisierung und offene Lizenzierung den eigenen Kulturschatz für alle zugänglich und nutzbar zu machen.
Im Denken die Richtung wechseln
Noch vor wenigen Jahren waren Museen sehr zögerlich, selbst Fotos von Kunstwerken aus den eigenen Sammlungen digital zugänglich zu machen. Das niederländische Rijksmuseum hat es früh verstanden, im Denken die Richtung zu wechseln. Während das Museum zehn Jahre für Umbauarbeiten geschlossen war, ging es mit einem neuen Ansatz ins Netz.
Das 2012 gelaunchte Rijksstudio ist nicht nur ein digitales Schaufenster ins Museum, sondern lädt ganz gezielt dazu ein, die gemeinfreien, hochauflösenden Bilder zu nutzen und selbst kreativ zu werden. Das Museum ermutigte in einer Kooperation mit Etsy, einem Online-Marktplatz für Selbstgemachtes, dazu, die eigenen Kreationen zu verkaufen und es prämierte besonders gelungene Ideen mit dem Rijksstudio-Award. Die Journalistin und Schriftstellerin Kathrin Passig hat darauf hingewiesen, dass solche Wettbewerbe nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass die häufigsten Nutzungen unspektakuläre Kleinstverwendungen sind – die aber nicht als weniger wertvoll betrachtet werden dürfen.
Das Rijksmuseum steht für einen Wandel im Selbstverständnis von Museen, deren Rolle in der Gesellschaft seit den 1970er-Jahren unter Schlagworten wie „New Museology“ kritisch diskutiert wird. Das Museum ist nicht länger nur Hüter des kulturellen Erbes mit der alleinigen Deutungshoheit über das, was gesammelt, bewahrt und beforscht wird. Museums-Besucher*innen sind nicht länger nur eine Zielgruppe, denen Museen Wissen vermitteln.
Sie werden vielmehr als Communitys verstanden, die Ansprüche an Einbindung im Sinne von Zugang, Repräsentation und Partizipation stellen. Dies ist auch in der im letzten Jahr vom internationalen Museumsrat ICOM erneuerten Definition von Museen reflektiert, die Museen als nicht-gewinnorientierte Institutionen im Dienst der Gesellschaft beschreibt, die ethisch, professionell und partizipativ mit Communitys arbeiten. Museen müssen sich die Frage stellen, wie das Wissen und kulturelle Erbe bestimmter gesellschaftlicher Gruppen in der Sammlung, Darstellung und Erzählung ihres Hauses repräsentiert sind.
Welche Möglichkeiten gibt es für jede*n einzelne*n, an der Wissensproduktion eines Museums zu partizipieren? Inwieweit wird allen Zugang ermöglicht und ist kulturelles Erbe für die Öffentlichkeit nutzbar?
Wie werden Museen digital?
Der Deutsche Museumsbund hat in seinem in diesem Jahr veröffentlichten Leitfaden als Standard formuliert, dass „im Interesse guter Kooperation und eines uneingeschränkten öffentlichen Zugangs zu den musealen Sammlungsgütern […] digitale Objektdaten von den Museen frei zugänglich zur Verfügung gestellt (Open Access) und, soweit rechtlich möglich, zur Nachnutzung freigegeben“ werden sollen. Dies geht natürlich über den Bestand der gemeinfreien Werke hinaus. Die aktuellsten Zahlen aus dem Institut für Museumsforschung stammen von 2021 und machen deutlich, dass hier noch einiges zu tun ist.
Mehr als die Hälfte der Museen mit frei nutzbaren digitalen Sammlungsobjekten stellte nur bis zu 10 Prozent ihrer Sammlungen Open Access zur Verfügung. Noch immer sind viele Digitalisierungsvorhaben auf Projektmittel, befristet beschäftigte Mitarbeiter*innen oder ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Diese Rahmenbedingungen müssen von den politisch Verantwortlichen dringend so ausgestaltet werden, dass die Digitalisierungsaufgaben verlässlich und dauerhaft geleistet werden können.
Mit der Digitalisierung alleine ist es nicht getan. Die Aufbereitung der Daten mit maschinenlesbaren und verarbeitbaren Informationen, ihre Verknüpfung mit Normdaten und Bereitstellung als Linked Open Data sind essentiell, um sie wirklich nutzen und auffinden zu können. Die Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Communitys bietet viele Potenziale, um Kulturgut anzureichern, zu rekontextualisieren und damit gemeinsam neues Wissen zu schaffen.
Der Kulturhackathon Coding da Vinci hat exemplarisch vorgeführt, wie aus offenen Kulturdaten innovative Anwendungen entstehen und eine Öffnung der Institutionen auf allen Ebenen gelingen kann: Notwendig sind frei lizenzierte Kulturdaten, offene Datenformate und auch die Bereitschaft zur institutionellen Öffnung. Das bedeutet auch, Kontrolle und Deutungshoheit über die eigenen Daten und ihre narrativen Zusammenhänge abzugeben.
Viel stärker noch als bislang sollten Museen den digitalen Raum als gesellschaftlichen Raum verstehen, der von ihnen mitgedacht und mit bespielt wird – auch um ihre gesellschaftliche Relevanz zu behalten. Sich als Institution in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, heißt im Digitalen, die Wissensallmende der Knowledge Commons mit zu pflegen. Daran wirken bereits viele Institutionen mit, aber für viele kommt es jetzt darauf an, im Denken die Richtung zu wechseln.