Einen Sammelband in einer renommierten Buchreihe herauszugeben, ist heute eine Erfahrung der besonderen Art. Noch konsequenter als bei Zeitschriften werden alle Arbeiten mit Ausnahme des Marketings auf Herausgeber und niedrig qualifizierte Arbeitskräfte in Billiglohnländern abgewälzt. Erfahrungsbericht eines Herausgebers.
Diesen Gastbeitrag von Lorenz M. Hilty veröffentlichen wir mit seiner freundlichen Genehmigung. Zuerst erschienen im „Informatik Spektrum“, Band 38, Heft 4, August 2015, S. 302–305.
Der Lektor am Telefon war ausgesprochen hilfsbereit. Er hatte sich über den Inhalt des Lehrbuches, das ich im Auftrag eines Professors überarbeitete, ausführlich Gedanken gemacht und gab mir in stundenlangen Telefongesprächen seine Erfahrungen zu Stil und Layout weiter. So lernte ich im Laufe eines Jahres einiges über die professionelle Produktion von Fachbüchern. Später sah ich den Band mit einigem Stolz in Buchhandlungen ausliegen, übrigens zu einem für Studierende erschwinglichen Preis.
Das war Anfang der 1990er-Jahre. Die Verlage hatten den Schriftsatz schon an die Autoren und ihre PCs ausgelagert, beschäftigten aber noch Lektoren, die mitdachten und sich Zeit für ein Buchprojekt nahmen, um die Qualität des Ergebnisses sicherzustellen. Diese positiven Erfahrungen hatte ich damals mit Springer, aber auch mit anderen renommierten Verlagen gemacht, in denen ich sowohl Monografien als auch Sammelbände publiziert habe.
Nichts ahnend fasste ich deshalb, mehr als zwanzig Jahre später, den Entschluss, erneut bei Springer zu veröffentlichen. Einen Sammelband, der die besten Beiträge einer internationalen Konferenz enthalten sollte. Wir wollten keine Proceedings im üblichen Sinne herausgeben, sondern einen sorgfältig editierten Band mit Kapiteln, die aufeinander Bezug nehmen. Weil Autoren heute an bibliometrischen Indikatoren gemessen werden, war es ein Glücksfall, dass Springer eine passende Reihe mit dem Hinweis „Now indexed by ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink“ bewarb. Mein Team organisierte einen Peer-Review-Prozess für die Buchkapitel, um die Qualität des Inhalts nach heute üblichen Standards zu sichern. Einem erfolgreichen Buch schien nichts mehr im Weg zu stehen. Doch es sollte ganz anders kommen – ein Drama in fünf Akten.
Erster Akt
Auf meine Anfrage hin zeigt Springer Interesse, unser Buch in der besagten Reihe zu veröffentlichen und schätzt den voraussichtlichen Verkaufspreis für die Printversion auf „99,99 Euro“. Das klingt zwar nicht gerade günstig, liegt aber im Rahmen des heute Üblichen für ein Werk dieses Umfangs. Wir unterzeichnen einen Vertrag, die Autoren beginnen ihre Arbeit, wir versorgen sie mit den – laut Springers Website – für diese Reihe maßgeblichen „Author Guidelines“ und einem vielversprechenden Paket von „Author Tools“. Einige Vorgaben sind sehr ungewöhnlich, beispielsweise das Format für Überschriften der dritten und vierten Gliederungsebene. Aus der Erfahrung heraus, dass Autoren solche Regeln gern ignorieren und dann unzählige Varianten produzieren, die nachträglich nur mit riesigem Aufwand zu vereinheitlichen sind, weisen wir unsere 47 Autorinnen und Autoren zusätzlich auf solche Besonderheiten hin. Auch darauf, dass alle Abbildungen für die Printversion auch ohne Farbe verständlich sein müssen.
Zweiter Akt
Zahlreiche Rückfragen zeigen uns, dass es Unklarheiten in den Guidelines gibt und Inkonsistenzen mit den „Author Tools“. Einige Autoren haben außerdem andere Guidelines von der Springer-Website heruntergeladen und sind nun überzeugt, dass diese für unsere Reihe gelten. Wir senden Listen mit detaillierten Fragen an den Verlag. Diese werden zwar beantwortet, die Antworten werfen aber häufig neue Fragen auf. Eine Lektorin schickt uns relativ spät eine neue Version von Richtlinien, die wir noch nie gesehen haben. Und den überraschenden Hinweis, dass wir uns „um Formatierungen nicht zu kümmern“ brauchen, weil das Buch „professionell gesetzt“ werde. Bitte prägen Sie sich diesen Satz gut ein, um das Kommende daran zu messen.
Dritter Akt
Eigentlich ist es eine gute Nachricht, dass sich Profis um das Layout kümmern werden und wir als Herausgeber damit nichts zu tun haben. Aber abgesehen davon, dass die Nachricht etwas spät kommt und im Widerspruch zu den Instruktionen im Web steht, fehlt mir der Glaube an dieses Wunder. Ich versuche weiterhin, ein möglichst einheitliches und ausgereiftes Manuskript abzuliefern. Wir schärfen den Autoren weiterhin ein, ab der dritten Gliederungsebene nicht zu nummerieren (wie in den Richtlinien verlangt) und lösen viele andere Detailprobleme. Wir achten darauf, dass die Literaturlisten aller Kapitel einheitlich formatiert sind. Und natürlich bestehen wir weiterhin darauf, dass alle Abbildungen auch ohne Farbe verständlich sein müssen, weil die Printversion bei diesem Preis ohne Farbbilder auskommen muss. All dies verursacht erheblichen Aufwand. Wir, die Herausgeber, betrachten es als Investition, die in einem weiteren Schritt – der Endkorrektur – allen Beteiligten Aufwand sparen und die Einhaltung des ambitionierten Zeitplans ermöglichen wird. Dann liefern wir die rund 470 Seiten an Springer ab.
Vierter Akt
Per E-Mail meldet sich ein freundlicher Herr von einer Firma in Chennai, Indien. Er sei im Auftrag von Springer für die Produktion unseres Buches zuständig, „in accordance with the Springer style guidelines“. Wir sind gespannt, welche Guidelines das nun sein werden. Als wir die PDF-Datei des gesamten Buches zur Korrektur erhalten, ist die Antwort klar: keine. Die Korrekturfahnen sehen aus, als hätte man sie mit einem Zufallsgenerator editiert. Für Überschriften ab der dritten Gliederungsebene gibt es neuerdings neun verschiedene Varianten, manchmal sogar mehrere in einem einzigen Kapitel. Zudem wurden in einigen Kapiteln die Überschriften gar nicht als solche erkannt. Keine der neun Varianten ist übrigens konform mit den Springer-Richtlinien für diese Reihe, einige davon enthalten sogar nummerierte Abschnitte. Sie erinnern sich: Genau das haben wir den Autoren mühsam ausgeredet.
Doch das ist lange nicht das einzige Problem: Platzhalter, die wir eingesetzt haben, um auf andere Kapitel des gleichen Bandes zu verweisen, wurden nicht aufgelöst, obwohl das mit mehreren Personen bei Springer per E-Mail vereinbart war; in den Literaturlisten aller Kapitel wurden die Titel sämtlicher Quellen automatisch auf Kleinschreibung umformatiert, einschließlich Abkürzungen, sodass wir in Hunderten von Fällen beispielsweise „it“ in „IT“, „un“ in „UN“, „oecd“ in „OECD“ zurückkorrigieren müssen; in einigen Kapiteln wurden Dutzende von Referenzen aus dem Text entfernt und dann „Author Queries“ generiert wie diese: „References [56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69] are given in list but not cited in text.“ Solche Schäden lassen sich nur mit Rückgriff auf das ursprüngliche Manuskript und auch nur mit einem Verständnis für den Inhalt (jawohl, das gibt es noch: Inhalt) in mühsamer Handarbeit reparieren.
Die Liste der Zerstörungen ließe sich fortsetzen. Ich sende eine seitenlange detaillierte Beschwerde an den indischen Auftragnehmer und zur Kenntnis an Springer. Sie enthält den Satz: „It is inevitable that someone who tries to understand will now look at both the current text and the author manuscripts and decide what has to be done.“ Sie ahnen schon: Diesen „someone“ wird es nicht geben, außer wir machen die Arbeit selbst. Wir sitzen in der Falle, weil wir das Buch auf einer kurz bevorstehenden Konferenz präsentieren wollen. Wer weiß, welche Verzögerungen mit einem Verlagswechsel und möglichen juristischen Auseinandersetzungen verbunden wären. Lassen wir das Projekt scheitern, ist alle schon investierte Arbeit – besonders die der 47 Autorinnen und Autoren – entwertet.
Problematisch ist, dass wir den Text in dieser Phase des Prozesses nicht mehr selbst ändern können und jede einzelne Korrektur explizit annotieren müssen. Viele Korrekturen führen in der Umsetzung durch die Profis zu neuen Fehlern, die von uns gefunden und in der nächsten Runde wieder korrigiert werden müssen. Das erinnert mich an alte Zeiten – an Softwareentwicklung im Batch-Betrieb. Es ist ein Gefühl, wie jemandem per Telefon das Töpfern beizubringen. Auf unsere Beschwerden reagieren sie mit langatmigen E-Mails, in denen sie um Nachsicht betteln: „Please bear with us!“ Also üben wir uns in Nachsicht, d. h. wir machen ihre Arbeit, machen Nächte und Wochenenden durch – zur Lösung lächerlicher Probleme, die vollkommen vermeidbar gewesen wären. Nachsicht durch Nachtschicht.
Springer hält es nicht für nötig, sich in unsere Kommunikation mit den Indern einzuschalten. Ein bestechendes Geschäftsmodell: Lass unqualifizierte Arbeiter zusammen mit gutmütigen Wissenschaftlern etwas erarbeiten, wobei Letztere kostenlos die Qualitätssicherung übernehmen, auch dann noch, wenn das Projekt zum Fass ohne Boden wird. Und lass dir alle Rechte am Ergebnis abtreten – als Gegenleistung dafür, dass du diesen Prozess mal eben schlecht und recht organisierst.
Fünfter Akt
Das Buch ist auf dem Markt. Die Geburtswehen, die es verursacht hat, sind ihm nicht anzusehen. Springer verkauft es nun zum stolzen Preis von 203 Euro, 253 Schweizerfranken oder 259 US-Dollar pro Exemplar (Printversion, Softcover). Der Unterschied zum ursprünglich genannten Preis ist nur teilweise dadurch zu erklären, dass es nun 474 statt 300 Seiten umfasst. Außerdem liege dem ursprünglich genannten Preis ein Irrtum seitens Springer zugrunde, wie man uns sagt. Einzelne Kapitel kosten online übrigens um die 25 Euro, was hochgerechnet etwa dem dreieinhalbfachen Preis der Printversion entspricht.
Doch der Preis bleibt nicht die einzige Überraschung. 26 der insgesamt 119 Abbildungen sind in Farbe gedruckt worden. Allerdings nicht diejenigen, bei denen die Farbe am meisten zum Verständnis beigetragen hätte. Niemand hat uns über diese Entscheidung informiert, niemand hat über die Bedeutung der Farben in den Abbildungen nachgedacht. Autoren melden sich bei uns und beklagen sich: „Wenn ich gewusst hätte, dass Farbdruck möglich ist…“
Es ist offensichtlich, dass es beim Verlag keine Person gab, die sich inhaltlich über dieses Buch Gedanken gemacht hätte. Ich vermute außerdem, dass niemand einen Überblick über den gesamten Prozess hatte. Wir hatten mit insgesamt sieben Personen bei Springer und seinem indischen Auftragnehmer zu tun. Diese wussten voneinander meist nicht, was mit uns abgesprochen war, wenn sie sich auch redlich bemüht haben, uns aus ihrer jeweils begrenzten Perspektive heraus zu unterstützen.
Eine weitere Überraschung war das Erscheinungsjahr: Obwohl am 22. August 2014 erschienen (auch als Printversion), steht im Impressum das Jahr 2015. Das muss uns nicht weiter stören, da das Buch dadurch nominell länger frisch bleibt, aber die Seriosität dieser Praxis ist zumindest diskutierbar.
Sieben Monate nach seinem Erscheinen ist unser Buch übrigens immer noch nicht „indexed by ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink“, wie es auf der Website von Springer so schön hieß, und entscheidend sind hier ISI und SCOPUS. Die Autoren beginnen sich bei mir zu beschweren, weil die Publikation für bibliometrische Indikatoren nicht zählt, solange Springer sein Versprechen nicht einlöst. Meine wiederholten Nachfragen bewirken nichts – außer dass Springer den Hinweis auf der Website subtil ändert. Es heißt neuerdings: „Indexing: The books of this series are submitted to ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.“ Die Formulierung „submitted to“ ist näher an der Wahrheit als die alte („now indexed by“), da Springer nach eigenen Angaben gar keinen direkten Einfluss auf die meisten dieser Dienste hat, da sie ja von Konkurrenten betrieben werden, und die Aufnahme eines Werks nur vorschlagen kann. Das bisherige Versprechen an die Autoren war also zumindest fahrlässig. Die Autoren scheinen sich damit scharenweise ködern zu lassen. In der besagten Reihe sind seit 2013 über 180 Titel erschienen, im Mittel also mehr als ein Band pro Woche. Eine Fließbandproduktion ohne jegliche Qualitätssicherung durch den Verlag. Springer gibt insgesamt rund 4.500 Buchreihen heraus. Das ist leicht möglich, wenn man damit so gut wie nichts mehr zu tun hat – außer Werbung zu machen, natürlich.
Bis vor zwei, drei Jahrzehnten haben Verlage noch Themen identifiziert, Autoren gefunden, beraten und betreut. Ihre Reputation haben sie erworben, indem sie die inhaltliche und technische Qualität der Werke sicherstellten. Außerdem sind sie erhebliche finanzielle Risiken eingegangen (und mussten deshalb wählerisch sein), da die Auflagen nicht beliebig klein sein konnten. Heute dagegen, im Zeitalter von „Print on Demand“, ist das finanzielle Risiko nahe null. Die Produktion wird, wie wir gesehen haben, in Billiglohnländer ausgelagert und die Qualitätssicherung komplett auf die Herausgeber und Autoren abgewälzt. Warum ist ein Wissenschaftsverlag lukrativer als eine Notenpresse? Richtig, die Banknoten müsste man selber drucken.
Mit diesem kritischen Bericht möchte ich nicht etwa die Mitarbeitenden des indischen Auftragnehmers für ihre mangelnde Ausbildung oder Erfahrung kritisieren. Was ich kritisiere, ist die rücksichtslose Externalisierung von Kosten durch den Springer-Verlag, der billige Arbeitskräfte einsetzen kann, weil er gleichzeitig die Qualitätssicherung an weitgehend aus Steuergeldern bezahlte Herausgeberinnen und Herausgeber abwälzt. Dadurch gehen die Kosten nach unten – die Verkaufspreise werden gleichzeitig erhöht, weil die Universitäten über ihre Bibliotheken und Konferenzen die von ihnen finanzierten Produkte bereitwillig zurückkaufen. Die Verlagstätigkeit reduziert sich auf Werbung mit einer Marke, die ihren Ruf der Arbeit einer früheren Generation von Profis – wirklichen Profis – zu verdanken hat.
Angesichts dieser Realitäten drängt sich mir die Frage auf, ob sich denn niemand um den Ruf einer erfolgreichen Marke sorgt – offenbar nicht. Eine naheliegende Erklärung ist, dass die renommierten Wissenschaftsverlage schon lange und in voller Absicht vom Glanz vergangener Zeiten leben. Noch umgibt die großen Marken ein Mythos von Qualität und Glaubwürdigkeit. Die Zukunft wird zeigen, wie lange man daraus noch Profit schlagen kann, ohne sich um die Einlösung des damit verbundenen Anspruchs zu bemühen – wie lange es dauert, bis der Gaul zu Tode geritten ist. Nachhaltig ist das nicht.
Diesen Text habe ich den Betroffenen vor der Veröffentlichung zur Kenntnis gegeben. Springer hat daraufhin seine Anstrengungen verstärkt, den Band wie angekündigt bei SCOPUS erfassen zu lassen. Dies ist geschehen, exakt acht Monate nach Erscheinen des Buches. Die Erfassung durch ISI steht weiterhin aus.
Nach der Erstpublikation dieses Beitrags in deutscher Sprache erhielt ich zahlreiche Zuschriften von Kollegen, die von ähnlichen Erfahrungen mit anderen Verlagen berichteten. Offensichtlich ist das hier geschilderte Problem nicht spezifisch für Springer, sondern die Auswirkung des heute vorherrschenden Geschäftsmodells in der Branche. Es spricht für die Trennung von redaktionellen und kommerziellen Belangen bei Springer, dass dieser Artikel in der Zeitschrift „Informatik Spektrum“ erscheinen konnte.
Lorenz M. Hilty ist Professor am Institut für Informatik der Universität Zürich und leitet die gemeinsame Forschungsgruppe „Informatik und Nachhaltigkeit“ der Universität Zürich und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa. Er ist außerdem Delegierter für Nachhaltigkeit der Universität Zürich und Affiliated Professor am „Center for Sustainable Communications“, CESC, des Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm.
Das von ihm und Bernard Aebischer herausgebene Buch hat den Titel „ICT Innovations for Sustainability“.

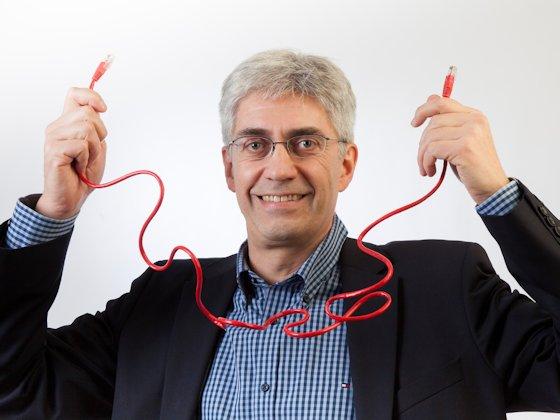



Mein Beileid.
Dass Qualität auch bei Wissenschaftsverlagen keine große Rolle mehr spielt, habe ich befürchtet. Dass es allerdings so schlimm ist, hatte ich nicht erahnt. Es passt aber in unsere Zeit, in der aus Sch… Gold gemacht wird. Und damit möchte ich nicht die Arbeit der Authoren diskreditieren, die sich viel Arbeit machen, ihre Mühe aber – wie in dem Artikel geschrieben – durch Lektoren verstümmelt wird. Es wird schon gekauft, wenn es einen hohen Wert für die Wissenschaft hat. Es gibt ja keine Alternative.
Und da (ein paar) farbige Seiten vorhanden sind, über deren Wertigkeit man stellenweise diskutieren müsste, und etliche Seiten gefüllt sind, verlangt man dann horrende Preise, sodass sie nur ein sehr eingeschränkter Kreis kauft. Ich habe damals für mein Standardwerk der Biologie knapp über 100 DM bezahlt. Heutzutage kostet dasselbe Buch, 6 Auflagen später, 100 €. Was hat sich so großartig verändert, dass den annährend doppelten Preis rechtfertigt? Der Seitenumfang ist nicht einmal um 25% gewachsen.
Hoffentlich gibt es da bald einen Wandel, sodass man sich wieder auf die Qualität besinnt. Aber was wären die Alternativen? Nur noch digital veröffentlichen? Das wäre zumindest billiger in der Herstelllung.
Interessant ist der Artikel auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Verleger vor einiger Zeit beklagt haben, dass die ebooks billiger sind als die Printversionen, da ja der Hauptteil (Kosten) für Lektoren usw. aufgebracht werden müssen, die auch bei ebooks anfallen.
Neuen Verlag suchen. Wenn die Namen der Autoren reputabel sind, braucht man kein Springer. Außerdem wollen die Kleinen mal zeigen, wie mans richtig macht.
Ihr Biologie-Standard-Lehrbuch – gestiegener Verkaufspreis: Schon mal drüber nachgedacht, wer die Zeichnungen in solchen Werken bezahlt..? Dasfinanziert zu 99 % der Verlag.
ist anregend und spannend geschrieben. Das hat für gute Unterhaltung gesorgt. Am interessantesten jedoch sind diese unscheinbaren Zeilen:
Gerne hätte der Rezipient näheres über bibliometrisches Indexing und die Motivationslage der Autoren erfahren. Ist es nicht ein wenig beschaulich, die so beworbenen Leistungen eines Verlags als „Glücksfall“ zu bezeichnen?
Irgendwie lässt sich das Bild eines geprellten Freiers mental nicht ganz ausblenden, wobei der Verlust des Freierlohns hier nicht gemeint ist. Die publizierende Gemeinschaft aus den Wissenschaften sind Teil und zugleich Problem eines selbst geschaffenen Systems mit eigenen Folterwerkzeugen.
Kritische Autoren, bei denen (vermeintliche) Bequemlichkeit und Service nicht so im Vordergrund stehen, haben mittlerweile nachhaltigere Modelle wissenschaftlichen Publizierens verwirklicht. Die Aura, bei einem „renommierten Wissenschaftsverlag“ publiziert zu haben, kann da natürlich noch nicht mitgeliefert werden.
Auch kein Mitleid gibt es bei der Vertragsgestaltung. Pacta sunt servanda. Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil. Gewiss, umfassende Rechteabtretung sind eine Pest unserer Zeit, aber man muss sich ja nicht an jedem Schmutz infizieren, oder? Ohne Autoren kein Verlagssortiment. Soviel Selbstbewusstsein darf man von einem Habilitierten schon erwarten.
Dem Springer-Verlag hingegen kann man nur gratulieren zu zu dem effizienten Geschäftsmodell. Dort hat man wahrlich den Olymp der Optimierung erreicht. Gleichwohl ist der Olymp gegenwärtig nicht mehr der bevorzugte Ort aufgeklärter Orientierung.
Und genau wegen solch katastrophalen Leistungen sind die Open Source Softwarepakete OJS (Open Journal Systems), OMP (Open Monograph Press) und OCS (Open Conference Systems) so attraktiv. Wenn Herausgeber und Autoren die Arbeit von Verlagen eh schon selbst erledigen müssen, warum also eine solche Leistung noch honorieren?
Immer mehr Universitäten, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im angelsächsischen bieten zumindest intern für Hochschulangehörige solche Installationen an. Mit deren Hilfe können Wissenschaftler eigenständig sowohl Journals als auch Monographien und Konferenzschriften publizieren.
Werte Wissenschaftler: macht mehr Druck an euren Universitäten und Universitätsbibliotheken, um Universitätsverlage zu gründen oder zumindest entsprechende Angebote einzurichten. Das Geld, das solchen Verlagen in den Rachen geworfen wird, kann um Längen besser angelegt werden. Man mag nun einwenden, dass Wissenschaftler sich nicht mit allen Publikationsschritten aufhalten wollen, aber letztlich müssen sie es ja dann doch, wie der Artikel ja eindrücklich beschreibt.
Diese Verlage kassieren beträchtliche Summen und verdienen gleich zwei mal: bei der Erstellung und beim Vertrieb.
Hört endlich auf, dieses System zu unterstützen, dass nur gut für die Bilanzen der betreffenden Verlage ist!
Gerade heute hat mir ein russischer Professor in einer ehem. Sowjetrepublik stolz erzählt, er habe in den letzten Jahren mehrere Bücher bei einem deutschen Verlag publiziert (auf russisch), nachdem ich ihn auf sein letztes Werk von 2010, das in der hiesigen Nationalbibliothek zu finden war, angesprochen hatte.
Zuhause nachrecherchiert – der tolle deutsche Verlag ist Lambert Academic, eine Marke von VDM/OmniScriptum, einem der größten Schrottverlage der Welt. Kein Wunder, dass sein Werk nicht in der Nationalbibliothek oder einem anderen relevanten Ort zu finden war, denn der Autor bekommt nur ein Exemplar, und die On-Demand-Preise möchte sich niemand leisten, vor allem, wenn der Verlag sich eigentlich nur durch die Verwertung von Wikipedia-Inhalten einen Namen gemacht hat.
Jetzt würde ich hier nur gerne noch Werbung für einen engagierten, qualitätsbewussten Setzer und seinen ebensolchen Redaktionspartner machen… ;)
Da der Beitrag der Wissenschaftsverlage zum wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozess immer weiter gegen 0 geht, ist die Lösung einfach: Die Universitäten müssen (wieder) ihre eigenen Verlage gründen. An Investitionen braucht man kaum mehr als einen ordentlichen Webserver den das universitäre Rechenzentrum verwaltet und anbindet. Dazu ein paar Räume in irgendeiner Ecke wo sonst niemand mehr arbeiten will. Wirklich gedruckte Veröffentlichungen gibt es eh kaum noch, und die paar wenigen kann man bei externen Dienstleistern machen lassen. Und an billigem Personal fehlt es den Unis doch wahrlich nicht. Die Hauptarbeit übernehmen irgendwelche studentischen Hiwis entweder mit wissenschaftlichem oder irgendwas-mit-medien Hintergrund, die Leitung ein paar Promovierte die man 12 Jahre lang in halbjährlichen Kettenzeitverträgen hält, hoch motiviert dank der Aussicht auf Festanstellung. Für die Finanzierung des Ganzen organisiert man auf dem Papier ein paar Kooperationen, nennt das ganze dann International, Interdisziplinär, Völkerverständigend, Genfrei, Nachhhaltig, … und erhält dann von völlig wissenschaftsfernen Politikern und NGOs schnell Geld rübergeschoben. Was davon übrig bleibt, können die Präsidenten der Unis dann nutzen um auf Hawaii ‚Konferenzen‘ zu organisieren.
Nicht die Verlage sind das Problem, die ganze öffentliche Forschung in D müsste reformiert werden. Das Verhalten der wissenschaftlichen Verlage ist da nur eine Spitze eines Eisberges.
Sollen die armen Inder jetzt ganz verhungern? An die wertvollen Arbeitsplätze dort denkt wieder keiner. Und bei uns ginge das Konzept der Frühverrentung von kostenfreien Praktikanten und Wissenschaftlichen Mitarbeitern in die Brüche. Kinder statt Inder will hier auch niemand reproduzieren.
Im Übrigen werden kaum mehr neue Erkenntnisse publiziert, sondern vorwiegend Texte zur Steigerung des bibliografischen Index. Wer braucht das schon? Ist doch egal ob da Schreibfehler drin sind oder nicht. Liest eh kaum einer.
%s/bibliografischen Index/bibliometrischen Index/g
universitätseigene Verlage wären ein schöner Beginn für eine Veränderung auch der Forschungslandschaft: Hier lohnt es sich einmal, das US-Vorbild nachzuahmen
Auch deshalb sollten alle Veröffentlichungen die durch öffentliche Mittel entstanden sind oder gefördert wurde (also eigentlich alles an den Unis) auch kostenlos angeboten werden (z.B. durch die Uni).
Die Verlage könnten dann nur noch für das verlangen was sie real geleistet haben.
Der Autor regt sich darüber auf, dass er für „sein“ 470-Seiten-Werk, für das ihm 47 Mitauoren zur Hand gingen, allesamt steuerfinanziert, wie er immerhin selbst bemerkt, keine Rundumbetreuung bekam. Pro Beteiligten sind das 10 Seiten, nach meinem Verständnis ein Klacks. Was ist daran so schwer, sowas gleich als fertiges PDF oder ähnlichem einzuliefern?
Ich hoffe das Projekt ist nicht an Überschriften unterhalb der dritten Gliederungsebene gescheitert. Was wird von Verlagen erwartet, bei denen zwar noch jedermann veröffentlichen, aber kaum noch jemand kaufen mag?
> Was wird von Verlagen erwartet, bei denen zwar noch jedermann veröffentlichen, aber kaum noch jemand kaufen mag?
Die Pflege bibliometrischer Indices. Das war ja offenbar die beförderte Erwartung:
„Now indexed by ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink“,
und dann auch der größte Schmerz, weil nicht vollständig erfüllt.
>>Lass unqualifizierte Arbeiter zusammen mit gutmütigen Wissenschaftlern etwas erarbeiten, wobei Letztere kostenlos die Qualitätssicherung übernehmen, auch dann noch, wenn das Projekt zum Fass ohne Boden wird.<<
Sehr geehrter Herr Hilty,
vielleicht lesen Sie sich diesen Ihren eigenen Satz noch mehrfach durch, damit Ihnen klar wird, warum es diese qualifizierten, sich Gedanken machenden Lektoren in den Verlagen nicht mehr gibt. Leute wie Sie, die deren Arbeit kostenlos übernehmen, sind zu einem erheblichen Teil daran beteiligt.
Dass Sie einige Absätze zuvor die mögliche Entwertung der Arbeit der Autorinnen und Autoren als Grund für die Fortsetzung des Projekts anführen, wäre fast amüsant, wäre es nicht so bitter.
Diese Geschichte ist jetzt nicht vollkommen neu. Siehe
https://www.math.upenn.edu/~chai/story/story.html
Mit teils ähnlichen, teils auch anderen lustigen Details, etwa Probeexemplaren des Buches, die derart verkleistert waren, daß sie quasi mit Hammer und Meißel geöffnet werden mußten.
Liebe Autoren und Herausgeber,
ich arbeite selbst in einem Verlag und kann jeden nur empfehlen: Gebt euer Manuskript NIEMALS an einen Verlag! Veröffentlicht im Self-publishing oder sucht euch eure Satzpartner selbst.
Ihr bekommt keinerlei kompetente Beratung von den Verlagen mehr und leider interessiert ihr die Verlage auch nicht mehr. Die Mitarbeiter, die ehrlich und beratend arbeiten wollen, werden aus Kostengründen ausgebremst und gekündigt wenn sie sich zu laut beschweren.
Ihr als Autoren habt da die Gelegenheit die gleiche Arbeit zu machen aber dafür den Umsatz nicht teilen zu müssen.
Kompetenzen im Verlag selbst sind kaum noch vorhanden, auch das Marketing wird ausgelagert!
Das Einzige was man zur Verteidigung der Verlage sagen kann, ist dass die Umsatzeinbußen so gewaltig sind, dass die ganze Branche ums Überleben kämpft.
Ob das allerdings eine blanko-Entschuldigung für alles sein kann, wage ich zu bezweifeln!
Gott sei Dank kämpft die Branche ums Überleben. Seit rund 15 Jahren erlebe ich dieses Desaster hautnah (ebenfalls in der Medienbranche tätig). Wann immer ich denke, schlimmer kann es nicht mehr werden, wird es noch etwas schlimmer. Also! Wie schon empfohlen: von Anfang an Self-publishing – besser wird das Ergebnis in jedem Fall sein, als das was Verlage inzwischen noch leisten können und wollen.
Ich bin Diplomingenieur und arbeite als Lektor in einem kleinen Verlag, in dem es anders läuft. Bei uns kümmern sich die Autoren ums Inhaltliche. Ich lese jedes Buch und bespreche fachliche Details mit den Autoren. Wir besorgen den Satz (den in Deutschland üblichen Setzerregeln folgend) und kümmern uns ggf. um Bilder mit eigenem Zeichenbüro (Strichzeichnungen werden möglichst nach DIN-Norm gezeichnet). Ich kümmere mich auch um Bildrechte, so mir Problemstellen auffallen bzw. ich darauf angesprochen werde. Sämtliche Dienstleister befinden sich in Deutschland, ebenso die Druckerei. Jedes Buch von uns findet sich im Barsortiment des Zwischenbuchhandels. Der Autor bekommt ein Honorar, das unternehmerische Risiko tragen wir.
Ich kann nur jedem Autor raten, sich „seinen“ Verlag gut auszusuchen und eine langfristige Zusammenarbeit anzustreben. Dazu gehören auch jahrelange Kontaktpflege und wiederholte Verlagsbesuche.
Ich suche mir meine Autoren allerdings auch genau aus. In der Regel spreche ich die potenziellen Autoren selbst direkt an. Das sind heute in der Regel Industriekontakte, die „Wissenschaftsautoren“ zieht es – aus welchem Grund auch immer – zu den ganz großen internationalen Verlagsmarken, die dann auch arbeiten wie ein Großkonzern.
Das sind dann aber sicherlich Bücher, die zwar wissenschaftlichen Standards genügen mögen, aber eben auch ein Publikum außerhalb der Forschung ansprechen sollen, oder? Praktiker in der Industrie lassen sich so einen Müll, wie ihn Wissenschaftler wegen der Publikationsanzahl ohne Aussicht auf Leser produzieren und Springer & Co. in ihren wissenschaftlichen Reihen verlegen, ja auch nicht bieten, und werden auch keinen Sammelband irgendwelcher Konferenzen kaufen, sondern eben gut lektorierte Handbücher.
Was hier beschrieben wurde, trifft zum Teil auch auf alle anderen Verlage zu. Qualität ist nicht mehr das allererste Kriterium. Das allererste Kriterium ist MARKETING! Verleger sind wie Ärzte zu hauptsächlich Geschäftsleuten geworden.
Wie konnte das geschehen? Warum macht man sich darüber so wenig Gedanken und akzeptiert das?
Die Welt ist zu einem großen Kaufladen geworden – in allen Lebensbereichen…
Danke für diesen Beitrag. Er zeigt, dass sich das intensive Engagement lohnt, das kleinere Fachverlage in Publikationen stecken. Damit entstehen Chancen für einen Umbruch in der Branche. Qualität und Verlässlichkeit ist nicht unbedingt ein Prädikat der Großen. Gerade kleinere spezialisierte Verlage haben in diesen Aspekten mehr zu bieten – übrigens auch verlässliche Ansprechpartner.
Als Lektorin in einem – allerdings geisteswissenschaftlichen – Wissenschaftsverlag, dem Alfred Kröner Verlag, der renommiert ist und auf eine inzwischen mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken kann, aber nicht, wie der von Ihnen beschriebene Verlag, zu den ›Global Players‹ gehört, kenne ich das Problem, das sich gerade mit Großverlagen ergibt. Ich möchte aber anfügen, dass es durchaus noch renommierte Verlage gibt, die sich eben nicht auf ihrem Ruf ausruhen, sondern stetig daran arbeiten: durch eine intensive Autorenbetreuung, durch eigeninitiierte Projekte, durch ein sorgfältiges Lektorat (ja: wir lektorieren noch!), selbstverständlich durch einen eigenen Satz und eben nicht durch Print on Demand, denn es ist ja auch wichtig, dass die Bücher in der einen oder anderen Buchhandlung zu sehen sind – zu durchaus erschwinglichen Preisen. Und das alles in der Regel ohne jeden Zuschuss. Insofern tragen Verlage wie unserer sehr wohl noch ein beträchtliches finanzielles Risiko. Dass wir dann unter den Praktiken der ›Großen‹ leiden müssen, indem wir mit ihnen in einen Topf geworfen werden, ist ärgerlich. Aber: Es lohnt sich zu suchen. Es gibt durchaus noch Verlage, die ihre Aufgabe ernst nehmen! Man muss sich nicht immer an die sogenannten großen Namen halten.
1. Untertitel: Wenn Narzissten publizieren.
Es ist wie mit der Gier. Wenn man sie hat, dann ist es immer noch nicht genug.
Und wer eitel ist, der sucht meist auch die Gesellschaft seines gleichen.
„Rennomierter Verlag“ oder „rennomierter Wissenschaftsverlag“ ist der Titel, den man nach Jahrzehnte langer erfolgreicher Verlagsarbeit verliehen bekommt oder sich vorzeitig selbst ans Revers steckt. Er strahlt Glanz und Ruhm aus, und vor allem Erfolg. Autoren wollen erfolgreich publizieren, auch wirtschaftlich.
Doch das Wirtschaftliche ist gegenwärtig auch das Problematische. Es hat eine hässliche Fratze, die man lieber nicht sehen möchte.
Wenn ich Ihnen, verehrte Frau Vogl hier persönlich antworte, dann ist da einzig der Verwendung des Wortes „renommiert“ geschuldet. Bitte fassen Sie das nicht als Kritik an Ihrem Verlag auf, hier geht es um die Entlarvung des Renommierten.
Man kann Verlagen schlecht vorwerfen, wenn sie mit diesem Zauberwort Autoren ködern. Sie kennen ihre Kundschaft, ihre Papenheimer. Ein Pfau diniert eher nicht in der kleinen, aber feinen Kneipe, da muss es schon der Sterne-Starkoch sein, auch wenn dieser gleichzeitig hunderten anderen gleichzeitig auch das edle Maul stopfen muss.
Narzissten leben von Ansehen und Anerkennung, aber auch von dem Anderer. Gewiss, es gibt sie, die Autoren, die durch eigene Arbeit ein eigenes Renommee erworben haben. Aber wozu brauchen sie dann noch das Renommee eines Verlages? Die Frage ist zum Nachdenken gestellt. Autoren, denen es am Selbigen mangelt, haben das allzu menschliche Bedürfnis, sich mit fremden Federn zu schmücken.
Ob nun Renomme-Jagd oder Renommee-Paarung, ich habe meine nicht klammheimliche Freude daran, wenn dabei Federn gelassen werden.
Es ging schlicht und einfach darum zu zeigen, dass nicht jeder Verlag sich auf seinem sogenannten Ruf ausruht, sondern es immer noch Verlage gibt, die ihre Arbeit ernst nehmen. Das Wort »renommiert« war dabei eine Antwort auf obigen Artikel, da es dort mehrfach vorkommt. Nichts weiter. Tatsächlich lohnt es sich aber für Autoren, sich einen Verlag auszusuchen, der seine Aufgaben noch ernst nimmt, denn was sorgfältige Verlagsarbeit aus und mit Texten machen kann, wird jeder selbst wissen, der sie einmal genossen hat. Natürlich suchen sich diese Verlage die Texte, die sie publizieren, aber auch sorgfältig aus – wenn sie sie nicht sogar selbst initiieren, was gerne vergessen wird.
> Es ging schlicht und einfach darum zu zeigen, dass nicht jeder Verlag sich auf seinem sogenannten Ruf ausruht, sondern es immer noch Verlage gibt, die ihre Arbeit ernst nehmen.
Das ist völlig in Ordnung. Ihr nächster Satz jedoch ist es nicht:
> Das Wort »renommiert« war dabei eine Antwort auf obigen Artikel, da es dort mehrfach vorkommt. Nichts weiter.
Jeder kann wenig weiter oben seine eigene hermeneutische Übung an Ihrer ersten Einlassung unternehmen und seine Ausbeute mit Ihrer Rechtfertigung vergleichen. Und plötzlich stehen Sie ziemlich begossen da.
Ich habe gerade bei Springer Gabler veröffnetlicht. Das Wort „gerade“ ist insofern irreführend, als dass das fertige Dokument im Februar bei der Lektorin war. Karneval und Krankheit – es vergingen die Monate. Im Juli wurde es dann endlich veröffentlicht. Am 10. Juli habe ich es bestellt. Heute ist der 27. August. Ich habe mein Buch noch immer nicht, trotz Anrufe und Anfragen beim Verlag. Und so übertrage ich Nietzsche mal etwas deprimiert auf die Arbeit in großen Verlagen, die höchstens mittelmäßig ist „aus dem selben Grunde, aus dem in grossen Küchen bestenfalls mittelmässig gekocht wird“.
„Nachhaltig ist das nicht“. schreibt Herr Hilty in Bezug zum Umgang eines wissenschaftlichen Verlags mit seinen Autoren.
Ich selbst bin Schriftsteller, wenngleich nicht im wissenschaftlichen Bereich. Aber eine fachliche Betreuung und Begleitung seitens des Verlags ist unerlässlich, der Lektor (gerade im wissenschaftlichen Programm) die zentrale Person. Es geht schlicht nicht ohne diese Betreuung. Natürlich kann man auch als Self Publisher in einem BoD-Verlag agieren, aber das bringt andere Schwierigkeiten mit sich; die Vertriebs-Beziehungen zwischen Buchhandel und BoD-Verlagen sind nicht so eingefahren und routiniert wie z.B. bei Springer, Kohlhammer, DeGruyter etc.
Noch einmal: die Betreuung und Begleitung seitens des Verlags ist unerlässlich. Wenn er daran spart, kann er sich im Grunde selbst einsparen. Hier ist die Chance kleinerer, qualitativ besser arbeitender und engagierterer Verlage. Groß bedeutet nicht wie das Beispiel Springer zeigt großartig.
Ich bin selbst Mitherausgeber einer Reihe im Springer-Verlag und kann von ganz ähnlichen Erfahrungen mit dem Verlag und insbesondere den indischen Setzern sprechen. Auch uns haben die Haare zur Berge gestanden.
Roland Becker-Lenz
Kann dies als Mitherausgeber einer Reihe bei Springer (und wir waren bei einem Kleinverlag, dieser wurde nur eben von Springer geschluckt, deswegen sind wir da!) nur bestätigen, es lief bei uns bisher genauso: Früher gab es einen Verantwortlichen vom Fach, der uns begleitet hat, jetzt heißt es inoffiziell: Unsere Reihe wird zu wenig verkauft, eigentlich haben wir gar keine Lust darauf, diese noch weiter bei uns zu veröffentlichen….
Wir haben allerdings ein eigenes Lektorat, uns wurde aber angeboten, dieses nach Indien zu verlegen, ergo unseren Lektor zu entlassen und auf die „langjährige Erfahrung von Springer“ zurückzugreifen. Ein Glück haben wir das bislang nicht gemacht und der Trend geht wohl dahin, dass wir unsere Buchreihe irgendwann selbst veröffentlichen. Ohne Verlag. Denn wir machen eigentlich alles: Layout, Lektorat, Peer-Review,… und liefern ein druckfertiges PDF beim Verlag ab, um dann Preise zu lesen wie 142,43 Euro oder 128,21 Euro. Nur, damit das Verlagslogo unten erscheint und man sich rühmen kann, bei einem „renomierten Verlag“ veröffentlicht zu haben.
Im übrigen: wir reden hier über einen Großverlag, welcher über 30% Rendite erzeugt. Jahr für Jahr, für alle nachlesbar in den offiziellen Geschäftsberichten! Da wird also jahrelang abgesahnt. Wird Zeit, dass sich die Dinge ändern.
Ein druckfertiges PDF, öffentlich gehostet auf auf einem Universitätsserver sollte eigentlich zum wissenschaftlichen Arbeiten ausreichen. Uni-Bibliotheken könnten notwendige Druck-Exemplare selbst herstellen oder herstellen lassen. Das alles sollte eigentlich kein Problem sein und könnte auch (renommierte) Fachzeitschriften überflüssig machen.
Wozu also noch Verlage? Wie oben verschiedentlich angedeutet, es geht den Autoren vorwiegend auch um die Pflege ihres persönlichen bibliometrischen Index. Dieser Aspekt ist bei der ganzen Diskussion noch nicht ausgeleuchtet.
Und man könnte geneigt sein zu glauben, manche Autoren benötigen Namen wie „Springer“ oder „Lancet“ oder vergleichbares wie eine blaue Pille, zur Entfaltung der vollen (wissenschaftlichen?) Potenz.
Es kommt drauf an, was mit der Publikation eigentlich bewirkt werden soll. Geht es darum, ein wissenschaftliches Fachbuch im Markt zu etablieren oder darum dilettantisch aufbereitet irgendwelche Paper möglichst dauerhaft zu archivieren?
Ich würde mir selbst als Lektor nicht zutrauen, ein Fachbuch komplett im Eigenverlag zu publizieren. Nicht ohne Grund gibt es bei Buchprojekten Überschneidungen zu verschiedenen Ausbildungsberufen. Bei uns zum Beispiel liest ein Lektor (Dipl.-Ing.) über den Text, Korrektorat macht eine Germanistin (M. A.), Schriftsatz, Layout und Umschlag macht ein Mediengestalter, Strichzeichnungen macht eine Technische Zeichnerin, Herstellung und Kalkulation (die Schnittstelle zur Druckerei) macht ein Dipl.-Ing. Dann wird das Fachbuch ja nicht nur gedruckt, sondern auch im Buchhandel platziert und auf Messen vorgestellt. In Fachzeitschriften werden Anzeigen geschaltet. In Vertrieb und Marketing arbeiten Medienkaufleute. Die elektronischen Fassungen (E-Book und Datenbank) wird von einem Mitarbeiter mit einem IT-nahen Beruf erledigt.
Und das sollen jetzt alles Universitäten auf eigene Rechnung übernehmen?
Ich habe 2 Bücher bei Springer (VS – Sozialwissenschaften ) veröffentlicht. Bin moment beim dritten. Bislang habe ich einfahc immer selber saubere PDFs abgeliefert, da ich das so von meinen Kollegen geraten bekommen habe, hat bislang ziemlich gut funktioniert, eine layout/satz Betreuung durch den Verlag habe ich nicht erwartet (ja, das ist durchaus traurig), und das daher selber in die Hand genommen, und das ging aber timmer sehr gut, Fehler hängen halt an mir (ja, ein schickes Lektorat hätte hier und da sicher nicht geschadet…aber ein paar RS Fehler seien mir/den Beitragenden des Sammelbandes hoffentlcih verziehen).
Die Bücher sind dann zwar relativ teuer, aber wenigstens musste ich nie was zuzahlen (Qualitätskontrolle lagert Springer VS über iihnen bekannte Reihenherausgeber / Gutachter ja auch aus).
ALs Wissenschaftler wird man heute eben auch zum kleinen Layouter / Setzer. Aber da das mittlerweile sogar mit Word halbwegs geht, ist das auch nicht mehr so wild.
P.s. vielleicht kann ich demnächst mehr erzählen, ein Bekannter über Ecken hat Praktikum bei Springer in Indien gearbeitet, ich muss mal mit ihm sprechen.
Das Grundproblem ist die seit 15 Jahren karzinös kultivierte, aber nicht objektivierbare „Leistungsproduktion“ von Wissenschaft im Stückgutmassenverfahren. Kranke Ideen produzieren kranke Reaktionen. Wissenschaft war immer kritische Kooperation, „Wettbewerb“ der primitiven Art für im Leben mit zu wenig Anerkennung gestrafte Karrieristen haben Verwalter mit mechanischen Gehirnen erfunden, denen jegliche intrinsische Motivation offenbar wie eine schwere psychische Krankheit vorkommt, die irgendwie ausgemerzt werden muss. Tausende Publikationen müssen heraus, um den Wettbewerbsplan zu erfüllen, egal welch‘ kleinteiliger, nervtötender Kram die Datenbanken belastet. Da der Zwang, sich mit nichts zu äußern, riesig ist, machen Verlage natürlich nichts mehr. Von Politik und Verwaltung sinnlos im Kreis getrieben, machen die Wissenschaftler nun auch noch alle Verlagsarbeit. Keiner hat mehr die Zeit, den Unsinn in Ruhe von außen zu betrachten. Fünf Jahre nichts publizieren und dann ein solides Buch im Eigenverlag (wenn möglich in Muttersprache), wohl auch für Naturwissenschaften eher bald der richtige Weg… Wohlweislich gibt es keine Untersuchungen dazu, was ein belgischer Sinnesphysiologe mit seinem englischen Paper meint und was ein brasilianischer Fachkollege aus dem Paper entnimmt. Das Grauen würde uns alle überkommen, selbst in den „exakten“ Wissenschaften, weil wir uns künstlicher Sprachen im Mantel des Englischen bedienen, die 5 Mikrometer neben dem Spezialfach kaum jemand versteht.. ECHTE Übersetzer nagen am Hungertuch, Turmbau zu Babel in Höchstform weltweit. Von wirklich komplizierten Dingen der Übersetzungstheorie will ich hier gar nicht reden, auch nicht vom Gesetz der leichten Veröffentlichung quasi bekannten Wissens. Wird es komplizierter, braucht’s 6-8 Gutachter, bis man 2 findet, die mehr als ihr Schmalfach bewerten können bzw. wollen. Das kann dann schon einmal 3 Jahre auch für ein normales Zeitschriftenpaper dauern. Also wird munter der 10. Aufguss gedruckt, welcher Landläufiges bestätigt. Das ganze System ist marode, aber Verdrängung ist ein Schutzmechanismus des Unterbewusstseins, damit das Leben „im System“ schön bleibt. Also weiter: Auf zum Xten 5-Jahr-Plan der Wissenschaftsprodukt-Initative! Inhalte sind sekundär. Wir haben die Forschung, wie sie sich Bertelsmann vor 20 Jahrn vorgestellt hat. Viele haben gewarnt, aber wie die Lemminge ließen sich die Geistesgrößen manipulieren, welche durch ihre Positionen eigentlich hätten vehemehnt intervenieren müssen. Nähe zur Politik statt kritische Distanz und Sicherung der Freiheit, welche in der Verfassung festgeschrieben stand. Willfährigkeit allenthalben. Von den jungen, die wie Ratten durch das System der Lebensunsicherheit und Kinderlosigkeit gejagt werden, durfte man es nicht erwarten. Was hier beklagt wird, hat klare politische Ursachen, wobei oft „gemeinnützige“ Stiftungen sich als Ideenproduzent für eher durch Ideenlosigkeit gestrafte Bildungspolitik fest etabliert haben. Wer diese Stiftungen hauptsächlich bezahlt, wird lieber verschwiegen. Aber unser Erinnerungsvermögen ist heute völlig gelöscht, da wir mit redundantem Informationsmüll von morgens bis abends zugeschüttet werden. Nun haben auch signifikante Teile der Wissenschaftsmassenproduktion ihren Anteil an diesem Rauschen, welches unsere Gehirne mit viel Energie hinwegfiltern müssen. Die Krönung sind „Neuigkeiten“, welche schon in den 1950igern publiziert wurden. Amnäsie, Überhöhung, Halbwahrheiten, Image… Ich beglückwünsche Frankreich und Russland. Aber auch von dort sickert schon so etwas wie „100 Publiklationen in 5 Jahren für Höchstpunktzahlen im universitären Leistungssystem“ durch. Der akademische Betrieb hat sich der Lächerlichkeit und Manipulierbarkeit durch Taschenrechnerbürokraten einer neu etablierten „Wissenschaftsmanagement-Branche“ preisgegeben, welche endlos neue Unsinnigkeiten für Kontrolle und Beschleunigung ausbrüten.
Aber wer will schon rufen, dass der König schrecklich nackt dasteht?
Die Verlage zu kritisieren, ist Fingerzeig auf EIN einfaches Symptom. Die Klinikaufenthalte und die Selbstmordrate von (jungen) Wissenschaftlern sollten wir auch einmal besprechen…
Da muss schon etwas mehr Rückgrat in die Manege gebracht werden. DFG, Max-Planck-Gesellschaft, Rektorenkonferenz, Bildungsministerien… – DORTHIN müssen wohl eher die Finger zeigen.
„Klare Bilder“, welche charakteristische Bilder von „Turmbau zu Babel“ sind, mit dem das herrschende Verständnis, in Bildern beliebig Charakteristisches, also auch das vom „Turmbau“, verstehen zu dürfen, widersprochen wird. Dieses herrschende Verständnis drückt sich aus als „künstliche Sprache“ (auch ohne „Mantel“) mit scheinbaren Begriffen, mit unsinnigen Wortekonstrukten, griffig verwendet, sowie mit unlogischen Aussagensätzen, in denen auch zu dem, wozu etwas auszusagen ist, als Eigenschaft, Wirkung, Tätigkeit, Gefühl eines Subjekts formuliert wird.
Also nicht weitere Bilder, sondern veröffentlichte Auseinandersetzung mit dem das Verstehen beherrschende herrschende Verständnis – „DORTHIN müssen wohl eher die Finger zeigen“
Lieber Professor Hilty, was ich nicht verstanden habe ist dies:
„Und lass dir alle Rechte am Ergebnis abtreten“ … warum unterschreiben Sie solche Verträge? Ich verstehe es wirklich nicht, da hilft mir auch kein Hinweis auf bibliometrische Indikatoren (gerade Sozialwissenschaftler_innen wissen doch, dass die Vermessung der Welt und des Denkens enge Grenzen hat). Es gibt inzwischen so viele alternative Lizenzmodelle und Publikationsmöglichkeiten…
Danke für den Bericht. Er wird hoffentlich weite Kreise ziehen.
Basis für ein Buchprojekt ist nunmal ein Verlagsvertrag. Das sind Standardverträge, die Rechteabtretung ist nicht verhandelbar. In diesen Verlagsverträgen räumt der Inhaber der Urheberrechte (Autor) dem Verlag (Rechteverwerter) umfangreiche Nutzungsrechte ein. Das ist in der Regel das ausschließliche Nutzungsrecht („exklusiv“), bei Tagungsbänden mitunter ein einfaches Nutzungsrecht.
Der Autor bekommt im Fall eines Fachbuches dafür ein vom Erlös abhängiges Honorar. Diese „Rechteabtretung“ ist bei vielen mit Unbehagen verbunden, dabei ist die Sorge unbegründet. Der Autor beauftragt ja extra den Verlag umfassend die Rechte am Werk zu verwerten, das kann ein Verlag aber nur, wenn er auch die entsprechenden Nutzungsrechte inne hat.
Ein Verlagsvertrag gilt zwar, wenn nicht anderes vereinbart ist, bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Wenn der Verlag die eingeräumten Nutzungsrechte aber nicht wahrnimmt, hat der Autor die Möglichkeit der Rechterückgabe. Diese „Rechteabtretung“ ist also nicht unbedingt für die Ewigkeit.
Wer nicht bereit ist, die Rechte an seinem Buchprojekt einem Verlag einzuräumen, braucht auch nicht bei einem Verlag vorzusprechen. Er entzieht der Geschäftsbeziehung zwischen Autor und Verlag schlichtweg die Grundlage. Die Zusammenarbeit ist ohne umfassende Rechteeinräumung sofort beendet.
Möglicherweise waren diese exklusiven Nutzungsrechte aber immer schon problematisch, es gab früher für Autoren nur kaum Ausweichmöglichkeiten. Die Digitalisierung brachte die Befreiung von diesem Knebel, nicht-exklusive Nutzungsrechte sind im Ebook-Publishing ja eher die Norm, zumindest im Bereich Belletristik.
Exklusive Nutzungsrechte mögen nett für die Verlage sein, eine absolute Berechtigung sehe ich aber nicht.
Bei nur einfachen Nutzungsrechten verwandelt sich der Verlag zum Druckhaus und kann auch nicht viel ausrichten. Print-on Demand-Anbieter verstehen sich in der Regel auch so, nämlich im Schwerpunkt als Dienstleister was den Druck angeht.
Es gibt noch einen anderen Aspekt: Wer als Autor partiell Rechte verschiedenen Verlagen einräumt, verlässt sein Fachgebiet und begibt sich in die Gefahr Rechte ungewollt doppelt oder diffus zu vergeben. Pannen bei Rechteeinräumungen sind extrem teuer, können einen Riesenärger produzieren. Das ist auch für Profis ein schwieriges Terrain. Ich hatte das schon, dass Autoren von uns zusätzlich einem anderen, stark international aufgestellten Verlag, Nutzungsrechte eingeräumt haben. Dieses „internationale Haus“ hat uns dann umgehend abgemahnt.
Was mich auch nervt sind Autoren, die ein fast gleichartiges Werk parallel bei einem anderen Verlag einreichen (darf der Autor nicht) und damit in Konkurrenz zu ihren eigenen Büchern treten und damit den Abverkauf wirksam abwürgen, sodass alle Beteiligten das Nachsehen haben.
Ich kann wirklich nur jedem empfehlen sich „seinen“ Verlag gut auszusuchen, diesen dann mit exklusiven Nutzungsrechten auszustatten und den Verlag einfach machen lassen. Anliegen des Autors sollte sein, ordentliche Texte abzuliefern. Rechtemanagement in einem internationalen Umfeld gehört sicherlich nicht dazu.
Sehr geehrter Herr Prof. Hilty,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung Ihres „Leidensweges“. Ich hoffe, dass viele Wissenschaftler und Autoren Ihren Text und die Kommentare lesen. Denn: Es gibt Alternativen!
Auch ich habe viele Jahre in einem Fachverlag als Redakteurin, Chefin vom Dienst und Projektmanagerin gearbeitet. In den letzten Jahren habe ich vor allem Fachbücher betreut, die für die jeweilige Branche einzigartig sind. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, aber Erfahrung und Genauigkeit zählen im Verlag leider immer weniger (womit sich die Verlage meiner Meinung nach auf lange Sicht das eigene Grab schaufeln, aber meist wird eben nur kurzfristig geplant – was unter der finanziellen Not auch nicht ganz verwunderlich ist). Mitarbeiter, die noch einen hohen Anspruch an „ihr“ Produkt haben, werden unter Druck gesetzt, schneller zu arbeiten oder sich gleich eine neue Arbeit zu suchen. Das hat aber für Sie und andere Autoren den Vorteil, dass es viele, wirklich sehr erfahrene Kollegen gibt, die selbstständig, in Teams oder kleinen Verlagen genau die Arbeit und Unterstützung leisten, die Sie – zu Recht – erwarten. Ich denke, es lohnt sich, hier am Anfang eines Projektes etwas mehr Zeit zu investieren, den richtigen Partner zu finden.
Viel Erfolg für Ihre nächsten Buchprojekte!
Naja, totalitärer Kapitalismus halt…
Hallo allerseits, man hätte auch folgendermaßen vorgehen können:
1. Texterstellung mit max. vier Überschriftenebenen, durchnummeriert, Format rtf, wegen Fußnoten, diese nach einheitlichen Richtlinien, einzige Textauszeichnung: kursiv.
2. Peer-Review per selbstorganisiertem Review-Prozess, die Namen / Einrichtungen der Reviewer in eine Danksagung zu Beginn des Buches, noch vor dem Vorwort.
3. Vereinheitlichung der Typografie durch einen gelernten Schriftsetzer hier am Ort.
4. Veröffentlichung des Buches bei Bod (Book on demand) für rund 40 Euro.
5. Inkasso der selbstfestgelegten Gewinnmarge (hier rund 30% des Ladenverkaufspreises) zur Auszahlung an die Rieviewer
6. Inkasso der entsprechenden VGWort-Beiträge zur Auszahlung an die Autoren.
Halten wir fest: der ganze Mist, der da oben in 5 Akten beschrieben wurde, entstand nur aus zwei, drei Gründen:
1. das Buch sollte im Geschäft ausliegen – das sind Wunschdenken und Naivität;
2. das Buch sollte in einer renommierten Reihe erscheinen – hier ist Eitelkeit am Werk;
3. das Buch soll billig produziert werden – da wurde am falschen Ende gespart: einer von hier, vom Fach vielleicht, sowohl typografisch als auch wissenschaftlich hätte das besser und ansprechbarer gekonnt als der Inder.
Natürlich bezeichnet man On-Demand-Printing-Unternehmen als Vanity Press. Aber dafür hat es ja eine Review für das Buch, bevor es in den Druck geht.
Gruß
In der Forschung haben Verlage doch eine gewisse Macht. Welche Ergebnisse veröffentlichen sie, welcher Forscher bekommt Unterstützung?
Bei Zeitschriften soll es Ablehnungen von Artikeln gegeben haben, der Inhalt wurde einige Monate später von anderen veröffentlicht.
Diese Machtposition der Verlage wäre beseitigt, wenn die Unis selbst Verlage hätten und selbst veröffentlichen würden. Allerdings würden dann vermutlich kein Zusatzlohn aus der Veröffentlichung an die ProfessorInnen fliessen, der Arbeitgeber macht ja die Veröffentlichung … die Frage ist dann nur der Vertrieb …
so negativ waren meine Erfahrungen bisher nie, vielleicht habe ich da auch einfach Glück gehabt. Wenn sich Verlage nicht mal mehr um den Vertrieb und Werbung kümmern, kann man gleich in einem Print on Demand Model publizieren, und ab 19 Euro gibt es eine ISBN, die dann wirklich auch bei online Händlern zu finden ist, und auch in den Buchhandelslisten zu finden ist. Marketing muss man dann eben selbst machen, was dann in dem Fall der Verkauf auf Konferenzen und über die beteiligten Kollegen sein wird. Nun ja, oft genug ist der Kreis der Produzenten nicht viel anders als der der Rezipienten (sagt eine Dermaptera Spezialist).
Noch krasser finde ich die Relationen bei Zeitchriftenartikeln, wo es kaum mehr Marketing gibt. Also los gehts in Richtung OpenAccess!
Vielen Dank für die Informationen, die für mich sehr nützlich sein werden.
Antonio Russo
Man kann diesen Artikel übrigens inzwischen auch beim Springer-Verlag selber lesen: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00287-015-0896-7 Kostet allerdings 34,95 EUR :-)
Toller Artikel! Ich habe leider ähnliches erlebt.
Schon sehr traurig wieviel wissenschaftliche Bücher, die durchaus das Potential für höhere Verkaufszahlen hätten, in der Titelflut versanden. Noch trauriger aber, daß die Preise so hoch sind, daß selbst der interessierte Leser sich übers Ohr gehauen fühlt, wenn er für ein Softcoverbuch 120 bis knapp unter 200 Euro ausgeben soll.
Ein Hardcover kostet in der Produktion heue nicht so sehr viel mehr als ein gut gebundenes Softcoverbuch, in dieser Preisklasse sollte dies allemal drin sein.
Die Unis drucken doch auch viel selbst, bzw. haben günstige Druckereien vor Ort. Weshalb vermarkten sie nicht gleich die Dissertationen, deren Ergebnisse ja auch größtenteils mit Steuergeld finanziert worden sind ?
Sehr geehrter Herr Hilty,
danke für diese Insights, jetzt wird mir klar, warum mir beim Lesen eines aktuellen Springer-Fachbuchs die Haare zu Berge stehen. Die Kapitel in dem Buch (Knoppe, Wild (Hsg.): Digitalisierung im Handel, Springer 2018.) sind teilweise redundant oder Werbeveranstaltungen der einzelnen Autoren für ihre Unternehmen. Grammatik- und Satzzeichenfehler lassen meine Augen schmerzen. Offenbar verwendet Springer nicht einmal mehr rudimentäre Lektoratsversuche.
Schöne Grüße
Sabine Deinhammer-Fischer