 Dieses Kapitel zur Einführung in die Netzneutralitätsdebatte ist ein Auszug aus dem Buch „Die digitale Gesellschaft: Netzpolitik, Bürgerrechte und die Machtfrage“, das ich im vergangenen Jahr zusammen mit Falk Lüke im dtv-Verlag veröffentlicht habe und was trotz Stand April 2012 immer noch aktuell ist.
Dieses Kapitel zur Einführung in die Netzneutralitätsdebatte ist ein Auszug aus dem Buch „Die digitale Gesellschaft: Netzpolitik, Bürgerrechte und die Machtfrage“, das ich im vergangenen Jahr zusammen mit Falk Lüke im dtv-Verlag veröffentlicht habe und was trotz Stand April 2012 immer noch aktuell ist.
Regeln für ein neutrales Netz
Die Funktionsweise von Fernsehen und Radio ist eindeutig und einfach: Deren Sende-Infrastruktur basiert bis heute auf der Idee der Ausstrahlung – sie senden, und wer möchte und technisch und finanziell dazu in der Lage ist, empfängt. Alle Empfänger bekommen das gleiche Signal, einen Teil des ständigen Datenstroms, der gesendet wird. Der »Sender« entscheidet, was in die Welt hinausgeht. Der »Empfänger« kann aus den verfügbaren Sendungen auswählen, aber ihre Inhalte nicht selbst bestimmen.
Bei diesem Prinzip liegt die Entscheidung über die Inhalte völlig in den Händen einiger weniger: Wer die Sende-Infrastruktur betreibt, kann auch entscheiden, was darauf enthalten ist. Ein wichtiger Teil der Sende-Angebote stammt von den sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, die sich durch eine Art Zwangsgebühren finanzieren. Wer ihr Angebot nutzt, muss dafür bezahlen. Wer es nicht tut, ebenfalls, sofern er oder sie nicht nachweist, dass der Empfang aufgrund mangelnder Geräte nicht möglich ist, oder sich nicht ausdrücklich von der Gebührenpflicht befreien lässt. Es gibt eine eigene Einrichtung für das »Einziehen« dieser Gebühren, wie es auf der Website der GEZ genannt wird. Wer einen Kabelanschluss hat, der bezahlt dafür an den Anbieter des Kabelanschlusses. Und der Anbieter kassiert gleich doppelt, nicht nur vom Empfänger. Für sein Angebot erhält er auch von den Sendern, deren Programm er in diese Infrastruktur einspeist, Geld – das sogenannte Einspeiseentgelt. Dieses Prinzip gilt grundsätzlich auch für Satellitenbetreiber und andere Verbreitungswege. Der Zugang zum Netz des Betreibers ist ein knappes Gut, und mit diesem knappen Gut lässt sich viel Geld verdienen – wenn es denn nachgefragt wird.
Das Internet und die Netze, die es bilden, funktionieren vollständig anders.
Die Infrastruktur des Netzes ist grundsätzlich »dumm«. Es interessiert sich nicht dafür, wer wem welche Inhalte schickt. Es ist dafür konstruiert, möglichst zuverlässig Inhalte von A nach B zu transportieren. Diese Kernfreiheit des Netzes ist nicht nur aus politischen Motiven unter Beschuss. Auch aus wirtschaftlichen Interessen heraus ist die Versuchung groß, in die Funktionsweise des Netzes einzugreifen. Auf der einen Seite ist es der Kampf der vordigitalen Industrie, die zum Schutz des sogenannten geistigen Eigentums immer wieder Vorschläge macht, am Internet und seiner Funktionsweise herumzuschrauben, um damit Einzelrechte durchzusetzen. Das wäre sogar möglich, wenn man das Netz komplett umbaut. Aber dafür müsste man so tief in seine Struktur eingreifen, dass es mit dem Internet, das wir heute kennen, nichts mehr zu tun hat. Noch sind wir in Deutschland nicht so weit wie zum Beispiel in Frankreich, wo es das Hadopi-Gesetz gibt (von Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’Internet). In Frankreich wurde eine eigene Behörde eingerichtet, die gegen Urheberrechtsverletzung im Internet vorgeht. Bei wiederholten Urheberrechtsverstößen ist das Abklemmen des Internetzugangs beim Übeltäter vorgesehen. Das ist der größtmögliche Eingriff in die Neutralität des Netzes.
Und es gibt noch ein zweites Bedrohungsszenario für die Freiheit im Netz, das auf den Wunsch mancher Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen zurückgeht, die für den Transport bestimmter Inhalte mehr Geld einnehmen wollen als für andere. Auf den ersten Blick klingt das sogar logisch: Manche Arten von Inhalten und manche Anbieter verursachen wesentlich mehr Verkehr in den Netzen als andere. Wäre es da nicht folgerichtig, den Transport dieser Inhalte und von diesen Absendern teurer zu machen als von anderen? Sollten nicht die Anbieter von Telekommunikation so wie die Anbieter von Kabelfernsehnetzen darüber entscheiden können, was zu welchen Bedingungen über ihren Leitungen wie transportiert wird?
Um das Problem zu verstehen, müssen wir noch einmal die Grundstruktur des Netzes betrachten.
Jeder im Internet ist zugleich Sender und Empfänger. Wenn wir eine Webseite aufrufen, senden wir ein Signal, dass wir etwas empfangen wollen. Und wenn wir möchten, können wir auf unserem Computer selbst Seiten anbieten, komplette Mailserver betreiben oder andere derartige Dienste. Unser aller Rechner sind Teil des Internets, vom Giganten Google bis hin zu Nora Normalnutzer, die in ihrer Zweizimmerwohnung in einer mittelgroßen deutschen Stadt sitzt. Wir alle sind an die Netze, die man zusammengeschaltet als Internet bezeichnet, angeschlossen. Jeder bezahlt für seinen Zugang, für die Bandbreite, also die gleichzeitig mögliche Übertragungsmenge von Daten, und für ein Übertragungsvolumen. Wir bezahlen dafür die Provider, die Anbieter, die unsere Anfragen über die Netze und durch das Internet zum Zielrechner und wieder zurück befördern bzw. die Verbindung dafür herstellen. Bisher gibt es für diese Dienstleistung keine Hierarchie. Nach besten technischen Möglichkeiten werden alle Daten von A nach B befördert, gleichgültig, um welche Daten es sich handelt.
Für die physischen Leitungen, auf denen der Datenverkehr stattfindet, sind die Telekommunikationskonzerne dieser Welt verantwortlich. Sie betreiben eigene Netze und nutzen fremde, sie haben ein komplexes System von Übergabepunkten, Ein- und Ausleitungen geschaffen. Wir, die Nutzer, sorgen dafür, dass in diesem System etwas stattfindet: Wenn wir beispielsweise auf YouTube gehen und sagen, dass wir uns ein Video anschauen wollen, findet Verkehr, englisch »Traffic«, statt. Die Bits und Bytes, die beim Aufruf selbst durch das Netz flitzen, sind so wenige, dass sie in ihrer Gesamtsumme für die Anbieter irrelevant sind. Doch sobald ein Video läuft, werden in einem kontinuierlichen Strom nennenswerte Datenmengen durch das Netz geleitet: von den Rechnern des Anbieters zu dem Rechner desjenigen, der sich das Video ansieht.
Die Datenmengen, die die Nutzer im Netz senden und abrufen, steigen. Die Netzbetreiber müssten eigentlich ihre Netze weiter ausbauen. Wenn immer mehr Menschen und Geräte immer häufiger und mit mehr Datenhunger das Netz nutzen, dann sind höhere Kapazitäten vonnöten. Hier setzt nun ein klassischer marktwirtschaftlicher Effekt ein: die Verknappung. Was knapp und begehrt ist, kann für einen höheren Preis verkauft werden als etwas, das in großer Menge zur Verfügung steht – unabhängig vom eigentlichen Wert. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, und wenn die Nachfrage hoch ist, kann der Preis hochgetrieben werden. Am formalen Preis möchten die Internetanbieter allerdings nicht drehen. Es gibt nämlich einen Wettbewerb unter den Anbietern von Internetzugängen, der nicht gerade mit Samthandschuhen ausgetragen wird. Was könnten die Firmen also stattdessen machen?
Sie könnten einfach den Verkehr auf ihren Leitungen manipulieren.
Manche Anbieter propagieren ein Modell, bei dem es bevorzugte und nicht bevorzugte Daten gibt. Sie wollen Daten »unterscheiden«, was im lateinischen Wortsinne diskriminieren heißt. Das kann man sich etwa so vorstellen: Wenn man ein großes Rohr für Flüssigkeiten nimmt, kommt am Ende immer das als Erstes heraus, was man als Erstes hineingepumpt hat. Pumpt man zuerst Wasser hinein, kommt am Ende wahrscheinlich zuerst Wasser heraus. Pumpt man nach dem Wasser Champagner hindurch, kommt am Ende mit dem Wasser der Champagner heraus. Man kann aber in dieses große auch mehrere kleinere Rohre hineinlegen: eines für Bier, eines für Wein, eines für Champagner. Dann bleibt vom großen Rohr weniger übrig, aber in den kleinen Rohren fließt immer etwas, unabhängig davon, wie viel im großen Rohr gerade los ist. Es hat eine garantierte Bandbreite, die dem Rest des Rohres nicht mehr zur Verfügung steht.
Der Vergleich stimmt nicht zu hundert Prozent. Das Internet hat keine physischen Rohrwände. Aber er kann das Problem gut illustrieren: Während vorher alle Daten durch das gleiche Rohr müssen und kein Unterschied zwischen ihnen gemacht wird, gibt es nachher jemanden, der entscheidet, wer wie viel von dem Rohr abbekommt. Und der damit auch die Bedingungen diktieren kann: Wenn du Schampus willst, dann kannst du an das Rohr mit dem Champagner angeschlossen werden. Das kostet dich allerdings mehr. Und wenn du das nicht möchtest, dann bleibt für dich noch das Restrohr übrig. Das ist zwar kleiner als vor der Einführung der Champagner-, Whisky-, Scotch-, Bier-, Rotwein-, Weißwein-, Schaumwein- und Schnapsrohre, aber das ist ja nicht das Problem des Anbieters, sondern das der Nutzer. Wenn man bei dem Bild bleibt, gibt es sogar noch eine Steigerung: Der Anbieter schaut am Anfang des Rohres, was hineingeschüttet wird. Wer nur Bier hindurchschicken will, wird daran gehindert. Das ist keineswegs Zukunftsmusik, sondern heute bereits in manchen Netzen Realität.
So gibt es Mobilfunk-Anbieter, die ihren Kunden »Internetzugänge« versprechen. Was sie in Wahrheit meinen, ist etwas anderes: Sie bieten Zugang zu Teilen des Internets.
Denn sie filtern bestimmte Arten von Verkehr einfach aus, sie behindern die Übertragung bestimmter Inhalte. Insbesondere eine Art von Diensten ist ihnen ein Dorn im Auge: die Telefonie über das Internet. Die Telefonie ist ein Geschäftsbereich, an dem die Telekommunikationsanbieter viel Geld verdienen. Technisch betrachtet ist »Voice over IP«, wortwörtlich »Stimmübertragung über das Internetprotokoll«, heute ein Standard, den auch die Telekommunikationsanbieter selbst intensiv in ihren Netzen verwenden. Wer heute telefoniert, tut dies in einem Großteil des Netzes in digitaler Form, auch wenn er selbst einen klassischen sogenannten Analoganschluss verwendet. Bei Mobiltelefonie gibt es seit 2009 in Deutschland keine analogen Zugänge mehr. Entsprechende Endgeräte können gar nicht mehr verwendet werden. Wenn wir in ein Telefon sprechen, werden digitale Daten erzeugt und diese dann über das Netz des Anbieters zum Zieltelefon übertragen, um dort wieder entschlüsselt zu werden. Diese Dienstleistung lassen sich die Anbieter teuer bezahlen – obwohl die Nutzer eigentlich günstiger direkt über das Internet telefonieren könnten, ohne den Umweg über das Telefonnetz des Anbieters. Wer dies dennoch tun will, der wird bei manchen Providern kurzerhand extra zur Kasse gebeten.
Und auch in einer anderen Hinsicht kastrieren vor allem die Mobilfunk-Anbieter den Internetzugang. Wenn ein Gerät einen Zugang zum Internet hat, dann kann es andere Geräte Huckepack nehmen. Das entspricht der Struktur des Netzes: Jeder einzelne Teilnehmer kann sein eigenes Unternetz aufbauen. Bei vielen Menschen steht zuhause ein sogenannter Router, der genau diese Funktion übernimmt: Er sorgt dafür, dass wir mit allen unseren digitalen Geräten ins Internet kommen – vom Laptop über das iPad oder Telefon bis zum modernen Drucker, dem wir einfach eine E-Mail mit einem Dokument schicken können und es dann ausgedruckt vorfinden. Manche Anbieter des sogenannten mobilen Internets unterbinden dies und verlangen für die Möglichkeit, dieses sogenannte »Tethering« (»Anleinen«) durchzuführen, einen Aufschlag. Hinzu kommt, dass in vielen Fällen unklar ist, was Internetprovider tatsächlich tun, und für den Einzelnen kaum festzustellen ist, ob, und wenn ja, wie die Leitungsanbieter in den Datenverkehr eingreifen.
Das alles sind erste Anzeichen dafür, dass bestimmte Akteure ans Internet selbst aus wirtschaftlichen Motiven heraus Hand anlegen.
Sie möchten die Funktionsweise des Netzes künstlich beschränken und statt dessen, was wir heute unter Internet verstehen, etwas anderes anbieten. Sie wollen aktiv dafür sorgen, dass bestimmte Arten von Inhalten, bestimmte Sender und Empfänger mehr für die gleiche Dienstleistung – den Datentransport von A nach B – bezahlen. Dafür werden andere benachteiligt, die das nicht tun. Statt eines neutralen Netzes gäbe es dann eine Mehrklassengesellschaft. Und die hätte es in sich.
Denn wenn man die Transporteure darüber entscheiden lässt, was auf ihren Leitungen zu welchen Bedingungen von A nach B gelangt und eine solche Entwicklung eines nicht-neutralen Datentransports im Internet ein paar Jahre fortschreibt, dann wird das Netz, wie wir es heute kennen, passé sein. Diejenigen, die sich den höheren Preis für das Senden von Informationen leisten können – allen voran die Megafirmen des Internets, auf deren Angebote kein Provider verzichten kann, weil ihm sonst die Kunden weglaufen –, sind noch da. Die kleinen und mittleren Anbieter bleiben im Datenstau des »Restenetzes« auf der Strecke. Und zwar nicht nur die kommerziellen, sondern alle, die heute so stark davon profitieren, dass es eben keine solche Unterscheidung gibt.
Neue Unternehmungen müssten viel Geld aufbringen, um überhaupt ansatzweise konkurrieren zu können. Heute sprechen wir davon, wie demokratisch das Internet ist. Das könnten wir uns bei diesem durchaus realistischen Zukunftsszenario sparen. Ein Internet, in dem die Provider die Bedingungen für die von ihnen transportierten Daten diktieren, wäre kein demokratisches Internet mehr. Seiten wie die allseits geschätzte Wikipedia könnten unter diesen Umständen schlicht nicht überleben.
Zwei Dinge sind zentral, wenn es um Regeln für ein neutrales Netz geht.
Wir müssen das Netz selbst vor Eingriffen in seine Struktur aus politischen und wirtschaftlichen Motiven beschützen. Und wir müssen gleichzeitig die Nutzer davor schützen, dass sie von Anbietern über den Tisch gezogen werden. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Man kann eine klare Unterscheidung treffen. Es gibt das Netz und seine Infrastruktur, und es gibt die Herrscher über die Leitungen, die für den reibungslosen und bestmöglichen Betrieb dieser Infrastruktur zuständig sind. Damit verdienen sie ihr Geld. Es ist nicht ihre Aufgabe, die Inhalte nach kommerziellen oder politischen Gesichtspunkten zu gewichten und zu sortieren. Für Inhalte und Dienste des Internets hingegen sind diejenigen verantwortlich, die sie bereitstellen und anbieten. Und sie sind auch dafür verantwortlich, dass den Nutzern kein Schaden zugefügt wird.
„Die digitale Gesellschaft: Netzpolitik, Bürgerrechte und die Machtfrage“ ist im dtv-Verlag erschienen, kostet gedruckt 14,99 Euro und 12,99 Euro als eBook.


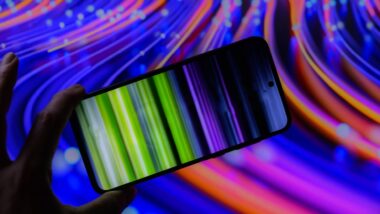

0 Ergänzungen
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr, daher sind die Ergänzungen geschlossen.