Wenn etwas nicht so läuft, wie gedacht: einfach draufhauen. Bumm, zack, Rübe ab! So funktioniert das Prinzip Ohrfeige, das als Erbe der sogenannten Schwarzen Pädagogik nach wie vor ganze Familien traumatisiert und zugleich Grundlage für Law-and-Order-Politik ist.
Nach diesem Prinzip will Australien nun das Problem angehen, dass soziale Medien vielen Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten bereiten. Was tun, wenn auf Sogwirkung optimierte Feeds den Jugendlichen die Zeit wegfressen? Wenn auf Radikalisierung abzielende Hetze in Jugendlichen Angst, Wut und Hass heraufbeschwört? Wenn propagierte Ideale von Schönheit, Macht oder Reichtum bei Jugendlichen Kummer und Selbstzweifel auslösen?
Die Antwort der australischen Regierung (verpackt im Online Safety Amendment Bill 2024) lautet: Einfach eine Altersgrenze draufklatschen und unter 16-Jährige rausschmeißen. Bumm, paff, basta – und den Kindern geht es wieder gut. Warum haben wir das nicht gleich mit harter Hand gelöst?! Die Tränen werden schon versiegen.
Das wird sowas von nicht funktionieren.
Alles, was Kindern schaden könnte, wird sie dennoch erreichen. Ins Visier genommen hat die australische Regierung nach eigenen Angaben unter anderem TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook und X. Das Internet ist aber voller Dienste, die weiterhin frei zugänglich sein werden: Weniger bekannte Plattformen, Imageboards, Messenger. Orte mit weniger Inhaltsmoderation und weniger Schutzmaßnahmen. Es dürfte sich auch rasend schnell herumsprechen, wie man jegliche Sperren kinderleicht umgeht, etwa mit VPN-Software.
Einige Dienste lässt das Gesetz ausdrücklich außen vor. Ausgenommen sind etwa Messenger und Gaming-Portale. Offenkundig haben Regierung und Gesetzgeber also begriffen, dass Kommunikation, soziale Kontakte und Spielen durchaus Grundbedürfnisse von Kindern sind, die man ihnen nicht wegnehmen sollte. Auch YouTube soll keine Alterskontrollen erhalten – mit der Begründung, dass es dort Bildungsinhalte gibt. Es wurde also auch begriffen, dass Kinder ein Recht haben, sich selbstständig zu informieren.
Kinder stärken statt aussperren
Wer das konsequent weiterdenkt, müsste gleich das gesamte Gesetz verwerfen. Denn auch auf den vom Gesetz betroffenen Plattformen wie TikTok und Instagram gibt es Bildungsinhalte und Messaging-Funktionen. Und auf den ausgenommenen Plattformen wiederum lauern ebenso Gefahren für Kinder und Jugendliche. Also was jetzt?
Wer Kinder und Jugendliche vor den Schwierigkeiten des Internets schützen will, muss sie stärken statt aussperren. Für den Umgang mit den Unwägbarkeiten des Internets brauchen Minderjährige Erfahrung, Übung, Medienkompetenz und vertrauenswürdige Menschen, mit denen sie sprechen können. Sie brauchen Zuwendung statt Verbote. Sie müssen Stück für Stück befähigt werden, bald selbst mit allem klarzukommen.
Inhalte sollten dem Entwicklungsstand angemessen sein, nicht dem biologischen Alter. Und gerade Kinder, die in der Klasse Ausgrenzung ertragen müssen – sei es, weil sie queer sind, neurodivergent oder einfach nur in einem komischen Rollkragenpullover zur Schule geschickt wurden – gerade diese Kinder brauchen Orte im Netz, an denen sie Gleichgesinnte und ein Zuhause finden können.
Ein Social-Media-Verbot für alle unter 16 Jahren gibt Kindern und Jugendlichen nichts davon. Im Gegenteil.
Das Social-Media-Verbot verhängt ein Tabu über Dinge, die junge Menschen so dringend brauchen: digitale Erfahrungen sammeln, digitale Verbindungen knüpfen. Also werden sie es heimlich tun. Während Eltern, Politik und Plattformen dem Irrtum erliegen, das Problem sei gelöst, man müsse sich um nichts mehr kümmern, treiben sich die Kinder an weniger regulierten Orten herum. Mit weniger Begleitung.
Mit scharf gestellten Alterskontrollen können Plattformen wie TikTok und Instagram sogar ihre sonstigen Jugendschutzmaßnahmen zurückfahren, Inhaltsmoderation ist teuer. Wer dann doch verbotenerweise im Erwachsenen-Internet herumlungert: selbst schuld.
Der australische Social-Media-Bann macht das Internet zu einem weniger sicheren Ort für Jugendliche. Und für Erwachsene.
Alterskontrollen für alle = schlecht für alle
Denn die Kehrseite der strengen Altersgrenze für Jugendliche sind strenge Alterskontrollen für alle. Millionenfach. Immerhin sollen die Plattformen prüfen, dass ihre Nutzer*innen wirklich erwachsen sind. Die Menschen in Australien werden es noch lieben lernen, fürs Betrachten von Kochrezepten auf Instagram den Ausweis zücken zu müssen.
Wie die Alterskontrollen genau ablaufen sollen, lässt das Gesetz offen. Wahrscheinlich werden mehrere Methoden zur Auswahl stehen. Immerhin soll es Alternativen zu Ausweiskontrollen geben, und die anfallenden Daten sollen nicht für andere Zwecke genutzt werden.
Wer sich nur flüchtig damit befasst hat, könne meinen: Ach, das klappt schon irgendwie. Tut es aber nicht.
Eine Übersicht der denkbaren Methoden für Alterskontrollen zeichnet ein finsteres Bild. Einigermaßen zuverlässige Alterskontrollen gibt es nicht ohne bedeutsame Nachteile. Viele Methoden erhöhen die Gefahr von Datenschutz-Katastrophen. Viele Methoden schließen vulnerable Gruppe von digitaler Teilhabe aus – etwa Menschen ohne Papiere. Wie man es dreht und wendet, unter den strengen Kontrollmethoden gibt es keine, die nicht schwere Bauchschmerzen bereitet.
Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die sprichwörtlichen Schweine zum Trog kommen und jemand sagt: Hey, lasst uns die millionenfach eingesetzten Alterskontrollsysteme doch für ein kleines bisschen Massenüberwachung nutzen, mindestens um Terrorist*innen zu schnappen. Und Einbrecher*innen. Und Falschparker*innen. Und alle, die laut irgendeiner als „KI“ verkauften Analyse-Software seltsame Klicks machen. Und so weiter.

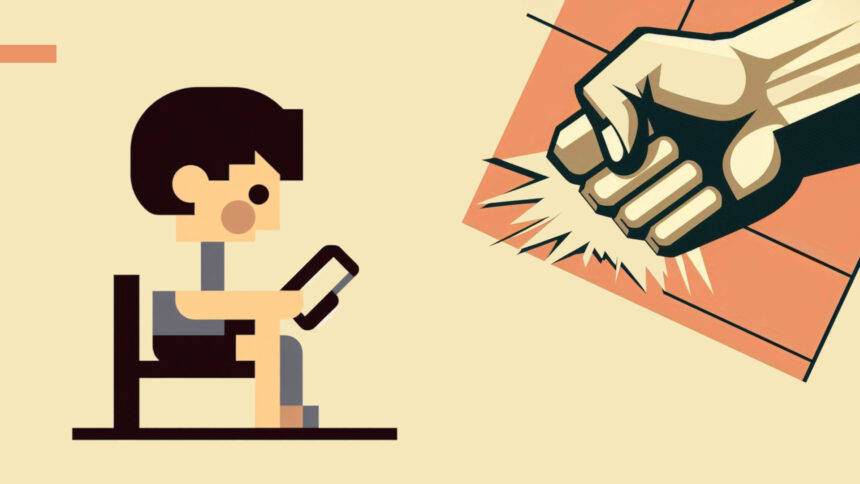


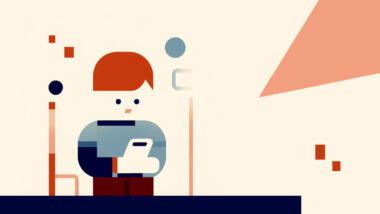
+1. Aber der Bauplan wird der EU und der BRD als Blaupause dienen, ebenfalls restriktive Maßnahmen einzuführen. Geht doch in AU, warum nicht in DE? Die Welt reißt von der Leine, konstatierte Hans Hartz schon 1982. Daran hat sich leider nichts geändert.
Sinnvoller wäre es gewesen Dienste wie facebook, instagram, youtube, tiktok usw. zu verdonnern ihren Share an dem Schaden den sie verursachen zu tragen. Mindestens finanziell. Mindestens 50% des Umsatzes. Der freie Markt wirds nämlich man ahnts schon nicht richten. Das machen dann die Faschisten später, anders.
Tut mir leid, aber der Artikel operiert mit einer 20 Jahre alten Haltung und ignoriert schlicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen, die in dieser Zeit gesammelt wurden.
Kids benötigen dringend (!) garantiert keine „digitalen Erfahrungen“ und warum Medienkompetenztraining nur „am Gerät“ möglich sein soll, obwohl es bei sämtlichen anderen Medien auch anders geht, erschließt sich mir nicht.
Mir scheint, dass hier schlichtweg eine Generation von Netzaktivisten stur immer dieselbe Leier fahren, anstatt ihre Haltungen den Entwicklungen anzupassen. Und die sehen zB so aus: „Studies suggest children are having their self-esteem harmed by filters that ape the effects of cosmetic surgery“ https://www.theguardian.com/media/2024/nov/29/teenage-girls-are-feeling-vulnerable-fears-grow-over-online-beauty-filters
Die Antwort auf sowas kann kein Account auf Snapchat sein, sondern eben Medienkompetenztraining in der Schule, meinzwegen auch manchmal (!) am lebenden Objekt (sozusagen), so wie man eben damals „Medienkompetenz für Fernsehen“ auch mal ausnahmsweise mit einem Video im Sozialkundeunterricht begleitet hat. Aber diese Dinge schließen sich nicht aus, ich kann sehr wohl Alterskontrollen und -grenzen für Kids einführen, ohne auf beispielhafte Anwendungen in der Schule verzichten zu müssen.
Ich will gar nicht behaupten, dass solche Altersgrenzen völlig unproblematisch sind. Aber sie sind nicht so problematisch wie das SocMed-Crack für parasoziale Bindungen, dass kognitive Verzerrungen erzeugt, die für Erwachsene bereits schädlich sind und überall gesellschaftliche Verwerfungen erzeugen, und bei Kids eben zu steigenden Zahlen in Mental Health Issues führen.
Ich bin diese Tech-Apologie von Aktivisten und den alten New-Media-Pionieren wirklich richtig dicke leid. Alles ist schuld an irgendeiner Entwicklung, außer dem einen Ding dass im global-gesellschaftlichen Maßstab wirklich neu ist. Denkfauler geht es nicht.
Danke – genau das war auch mein Gedanke. Ich versteh überhaupt nicht, warum so viele Menschen glauben, Kinder/Jugendliche hätten ein Grundbedürfnis/-recht auf diese kaputte Online-Welt. Es sind schon einige Generationen glücklich ohne Social Media groß geworden. Und man kann easy auch ohne Social Media in der Kindheit später klarkommen in einer digitalen Welt.
Dass es am Ende nichts bringt, könnte leider stimmen. Bin gespannt was in Australien rauskommt.
Ich denke auch, der Kommentar von Sebastian Meineck zeigt eine naive Sichtweise.
Natürlich kann man aus netzpolitischer Sicht die australische Regelung kritisieren. Aber aus jugendpädagogischer Sicht gibt es einige Argumente, die für ein solches Vorgehen sprechen. Er sollte dann lieber bei der netzpolitischen Sichtweise bleiben.
Ich verstehe das so, dass für Differenzierung geworben wird. Man sollte den wissenschaftlichen Stand, oder wenn noch jung, dann eben die Studienlage mit einfließen lassen.
Rating AAA :)
Sehr schöner Kommentar, mir erschließt sich der direkte Zusammenhang zwischen digitale Erfahrung, Kompetenz und „Sozialen“ Medien überhaupt nicht.
„Das Social-Media-Verbot verhängt ein Tabu über Dinge, die junge Menschen so dringend brauchen“
WIRKLICH? Brauchen tut der Mensch Nahrung, Wasser, Schlaf, Beziehungen… aber bestimmt kein FB, X oder so.
Dieser Satz sagt alles über den Kommentator. Es ist seine Welt und der Rest der Menschheit hat das auch so zusehen.
Ein bedauerlicher Kommentar, denn er unterstellt „Schwarze Pädagogik“. Ich halte das für abwegig und weit verfehlt. Warum dieser Fehlgriff im Duktus? Braucht es so ein emotionales anheizen, damit die Spenden zum Jahresende sprudeln? Und ist das nicht auch schon subtile Hetze gegen australische Regulierer?
Mag sein, dass Tränen bei social-media-addicts fließen, aber wieviele Tränen werden Kindern erspart, die nicht mehr auf den Plattformen beleidigt, gehetzt, gemobbt, und in den Suizid getrieben werden können? Das sind die Schwachen, die geschützt werden müssen.
Die australische Regierung hat verantwortungsvoll im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gehandelt. Respekt dafür!
Alterskontrolle für alle ist dort angesagt, wo sich Menschen schädigend verhalten, denn das ist schlecht für alle!
„Einige Dienste lässt das Gesetz ausdrücklich außen vor. Ausgenommen sind etwa Messenger und Gaming-Portale. Offenkundig haben Regierung und Gesetzgeber also begriffen, dass Kommunikation, soziale Kontakte und Spielen durchaus Grundbedürfnisse von Kindern sind, die man ihnen nicht wegnehmen sollte. Auch YouTube soll keine Alterskontrollen erhalten – mit der Begründung, dass es dort Bildungsinhalte gibt.“
Man denkt instiktiv vielleicht, dass die betroffenen Plattformen besonders viel Algorithmengewicht und Krisenpotential bergen. Sich gegenseitig beleidigen und dann IRL treffen und Rache üben, wird es mit den anderen Plattformen allerdings auch geben. Hier wäre interessant, ob und was für Statistiken bemüht wurden. Das Argument, die Kids würden den aggressiveren Algorithmen entzogen, bleibt schwierig, denn solange personalisierte Werbung und Tracking nicht verboten sind, kann da sonstwas passieren. Youtube nutzt auch Empfehlungen. Ausweichplattformen oder Accounts bedeuten volles Tracking, ohne gesetzlichen Schutz. Tatsächlich konsequent wäre also nur, weitestgehend alles personalisierte zu zerstampfen, sowie Empfehlungen so umzuzwingen, dass jegliche Optimierungen nach Umsatz, Clicks, Stay-time o.ä. nicht stattfinden. Im Grunde also bleibt eigentlich nur, äh, dichtmachen!
als studierter pädagoge kann ich dazu nur eines sagen: fail auf ganzer linie!
der Autor sollti sich in diesem Fall dafür stark machen, dass der Jugendschutz gleich komplett abgeschafft wird und Alkohol, Zigaretten und FSK beschränkte Medien für alle ab 0 Jahren zugänglich sind. Hier geht es ja auch nur um Verbote auf Basis eines Mindestalters (Jugendschutz). Alternativ könnte er sich auch mal mit Pädagogik befassen. Netzpolitik enttäuscht mich hier auf ganzer Linie.
Hier der Link wo die Ausnahmen definiert sind:
http://www7.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_act/osa2021154/s13a.html
Auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Kann man dann schön zusehen was für desaströse Auswirkungen es haben wird. Ich „freue“ mich schon wenn es dann die entsprechenden Datenabflüsse geben wird. Bekommen wir endlich mal eine ordentliche Datenbank entweder aller Insassen von Australien >=16 oder halt <16.
Aber ich vermute (befürchte) unsere Politiker (angefangen von Zensursula bis Überwachungs-Faeser) werden es mögen.
Jo Klaus da hast du recht, aber angeblich sollen 67 % in Deutschland auch dafür sein sowas einzuführen. Naja wenn man dat Alter der meisten Wähler betrachtet, dann wundert man sich nicht. Uralte Säcke verstehen die Jugend halt nicht. Sieht man ja auch an anderen Sachen.
Den Ausdruck „Uralte Säcke“ würde ich jetzt mal als nicht so nett werten, aber die Wählerschaft demografisch eher den Älteren zuordnen. Leider sind doch recht viele von diesen Menschen sehr unbeholfen, oft auch völlig überfordert bei Digitalen Themen und/oder verstehen viele dieser „Neuen“ Dinge nicht wirklich. Das ist schon aufgrund des Digitalzwangs der immer mehr um sich greift ein sehr großes Problem.
Na ist doch super, jetzt können wir uns wenigstens das ganze Geschnatter um „Kinderschutz“ sparen. Ehrlich, das Internet ist so sicher wie der Markt hinter der Bosnisch-Serbischen Grenze. Kinder haben dort nichts zu suchen.
Vielleicht wäre der Trick doch beim Anschluss selbst anzusetzen. Würde man die TK-Regulierung derart gestalten, dass altersklassifizierte (Unter-)Verträge gibt, dann könnte anhand eines möglichst wenig sprechenden Markers ohne weiteres Zutun die Altersstufe des Anschlusses identifiziert werden. Das wäre recht arbeitsarm. Dann obläg es den Eltern noch einmal dezidiert und an nur einer zentralen, immer kompatiblen Stelle darüber zu entscheiden, ob sie ihr Kind vor schädlichen Medien schützen möchten oder nicht.
Coole Idee. Und wenn der Kinder- und Jugend-Schutz von den Eltern auch ausgeführt würde und nicht umgangen werden könnte dann wäre das Thema ja auch erledigt. Es bräuchte dann keine Alterskontrollen mehr auf jeder einzelnen Seite, es würden auch keine Datenströme mehr fließen welcher Erwachsene wann und wo „erwachsenenunterhaltung“ konsumiert, etc, p.p. … und die „Kinderschutz“-Fundamentalisten würden (durch Wegfall der Grundlage) endlich als das bloß gestellt was sie sind, Religiöse Eiferer die ihre Vorstellungen von Moral allen anderen aufdrücken wollen – ob die es gut fänden oder nicht.
Der Letzte Punkt wäre ein Pro-Argument, der davor (die „Daten“interessen) wird das aber wohl wirksam zu verhindern wissen.
Das Ü16-Gesetz bräuchte man dann auch nicht mehr. Aber Kinder und Jugendliche sind und bleiben ja dennoch eine Zielgruppe des Marketings.
Sollte man derlei Beschränkungen also vielleicht auch auf jede Form von Werbung anwenden? Und welchen (künstlichen) Aufschrei „Interessierter Kreise“ über den damit verbundenen Wirtschaftlichen (Total)schaden würde es wohl geben.
Ja, manchmal befürchte ich wir leben alle nur um der Wirtschaft zu dienen – durch konsumieren. Es sollte umgekehrt sein. Finde den Fehler!
Wir brauchen stattdessen wohl eher eine Ertüchtigung der Eltern im Umgang mit Kinderschutz der seinem Namen auch gerecht wird.
Ich hätte ein Verbot anders vermittelt. Kinder und Jugendliche dürfen nicht für Werbezwecke missbraucht werden.
Oder:
Nur Social Media, dessen Quellcode öffentlich einsehbar ist und welches nicht durch Werbung und Daten finanziert wird, darf von Kindern und Jugendlichen verwendet werden.
An alle die das gut finden:
Sorry, aber denkt ihr auch mal darüber nach, was die Auswirkungen von dem ganzen sind bzw sein werden? Glaubt ihr allen Ernstes, dass es bei Social Media wie facebook etc aufhören wird?!
Kinder-/ Jugenschutz ist eine Sache – was völlig anderes ist aber das, was aus diesem Experiment heranwachsen soll und vermutlich auch wird.
Wenn ich sowas lese:
„Alterskontrolle für alle ist dort angesagt, wo sich Menschen schädigend verhalten, denn das ist schlecht für alle!“ und ein bisschen weiterdenke rollen sich mir die Nägel hoch.
Schädigendes Verhalten von Menschen kann immer und überall stattfinden – auch z.B. bei im E-Mail-Verkehr. Befürworten also dann jetzt diese Leute eine Ausweispflicht für E-Mail-Provider – und übersehen dabei (evtl absichtlich?), dass E-Mails heutzutage z.B. eben in Form von Online-Accounts quasi erst den Zugang zu allem Digitalen darstellen?
Wenn diese Daten dann mal gehackt werden sollten – viel Spaß. Nutzer der Dienste können nie sicher sein, wie der Anbieter die Daten sichert. Es basiert auf Vertrauen, dass er das tut, was er schreibt. Wenn ein Anbieter die Daten nicht gut genug sichert, bzw nicht Wort hält und die Ausweisdaten nach Verifizierung sofort löscht und dieser Dienst mal gehackt wird hilft den Personen, die dann evtl von Identitätsdiebstahl betroffen sind, auch keine Klage gegen den Anbieter.
Identitätsdiebstahl ist Identitätsdiebstahl. Punkt.
Naja, email ist doch eine eher private Kommunikation, social media hingegen so etwas wie öffentliches Senden an alle. Schlechter Vergleich und whataboutism.
Möglicher digitaler „Identitätsdiebstahl“ ist kein valides Argument, denn man müsste schon ziemlich neben der Spur stehen, wenn man die Abschaffung von Personalausweisen fordern würde, nur weil einem der Perso ja möglicherweise gestohlen werden könnte.
„Naja, email ist doch eine eher private Kommunikation, social media hingegen so etwas wie öffentliches Senden an alle. Schlechter Vergleich und whataboutism.“
Tatsächlich?
Als damals unter Seehofer die Ausweispflichtsdebatte aufkam wollte er das auch für Messenger und E-Mail haben
https://www.heise.de/news/TKG-Novelle-Seehofer-fordert-Online-Ausweispflicht-durch-die-Hintertuer-5070956.html
Und auch die Chatkontrolle der EU fordert ja mindestens für Messenger den Ausweis.
Warum sollte das dann bei E-MAILS anders sein? Auch darüber kommuniziert man mit anderen.
„Möglicher digitaler „Identitätsdiebstahl“ ist kein valides Argument, denn man müsste schon ziemlich neben der Spur stehen, wenn man die Abschaffung von Personalausweisen fordern würde, nur weil einem der Perso ja möglicherweise gestohlen werden könnte.“
OK, und warum gibt es das dann nicht heute schon auf sämtlichen Seiten, wo man einen Account anlegen kann?
Bzw warum wird von Seiten der Datenschützer immer dagegen Sturm gelaufen, wenn ja angeblich nichts passieren kann?
Abgesehen davon war von Abschaffung von Personalausweisen keine Rede.
Das normale Vorzeigen eines Ausweises ist meiner Meinung nach was völlig anderes und weitaus weniger risikoreich als auf irgendeinem öffentlichen Portal ein Bild davon hochzuladen
Nachtrag:
Auch gerade im Hinblick auf so Sachen wie die „Going dark“-Gruppe der EU, die die VDS massiv ausweiten will, sichere Verschlüsselung zerstören will und weitere abartige Überwachungsmaßnahmen will oder auch das „Sicherheitspaket“ mit der biometrischen Überwachung ist mir unbegreiflich, wie man das befürworten kann.
Wer garantiert denn, dass die nicht auf die Idee kommen, die Provider zu verpflichten gleich den ganzen Ausweis auf Vorrat zu speichern? Eine Möglichkeit das zu richtig prüfen, hätte ich als Nutzer ja eh nicht.
Beim Lesen des Artikels dachte ich: „ja ok, sehe ixh auch so. Aber was sollen wir denn sonst machen?“
Beim Lesen der Kommentare denke ich, diese Diskussion hier ist exemplarisch für das was das Internet mit uns macht: Es macht uns zu schwarz/weiss – sehern.
Eine gute alte Dialogtechnik ist es, zunächst das Argument der Gegenseite aufzunehmen und dann zu erwiedern.
Ja, soziale Medien sind ein Problem für junge Menschen, aber erstes ist das auch micht schwarz/weiss, auch hier gibt es nicht *nur* Nachteile. Zweitens ist die in AU angestrebte Lösung problematisch aus folgenden Gründen:…
Und aus Seite der Kommentare von „Hetze“ und „Fail“ zu sprechen zeigt auch nur das.man nicht in der Lage ist mehr als eine Seite eines Problems zu sehen.
Und weil das so ist können wir keine sinnvollen Lösungen mehr erarbeiten. Und deshalb werden die Probleme immer größer, bis sie uns über den Kopf wachsen.
Das sieht man am Internet recht gut, und eben auch auf dieser Seite.
Pauschalisiert das wohl nicht ein bischen bzgl. der Kommentare?
>>> Und weil das so ist können wir keine sinnvollen Lösungen mehr erarbeiten. Und deshalb werden die Probleme immer größer, bis sie uns über den Kopf wachsen.
Nach kaum einer Woche Kommentare schon den Kopf in den Sand?
Nach Tod von drei Teenagerinnen in Hohenwart: Kritiker sehen auch Plattformen wie TikTok in der Pflicht
Pforzheim. Seit dem Tod von drei Teenagerinnen in Hohenwart sind insbesondere auf TikTok zahlreiche Videos rund um die Tragödie im Umlauf. Auch melden sich seither immer wieder Leserinnen und Leser bei der PZ, die in diesem Kontext konkret auf gefährliche Beiträge auf der Plattform hinweisen: Etwa solche, die Suizid oder Suizidgedanken darstellen sowie Inhalte, die zur Beteiligung an selbstverletzenden Handlungen aufrufen. Im schlimmsten Fall wird Suizid in diesen Videos normalisiert oder gar als positiv dargestellt.
https://www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-Nach-Tod-von-drei-Teenagerinnen-in-Hohenwart-Kritiker-sehen-auch-Plattformen-wie-TikTok-in-der-Pfli-_arid,2148822.html
Danke für diesen absolut notwendigen Kommentar.
Es kann eigentlich nur übel enden: Unter 16 ein Totalverbot, ab 16 bleibt alles beim Alten.
Eine sinnvolle gesetzliche Regulierung von Online-Plattformen, welche z.B. bestimmte Dark Patterns zur Suchterzeugung verbieten könnte und generell anstreben sollte, das Netz für Menschen aller Altersklassen besser zu machen, wird man mit solchen Holzhammermethoden jedenfalls kaum erreichen.